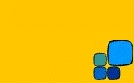Pressespiegel
- TAZ 23.1.2003
2.000 hier - 100.000 dort
Die Foren in Davos und Porto Alegre - TAZ, 23.1.2003
Zwei Orte, zwei Geister - TAZ, 23.1.2003
Offene und geschlossene Kreise - TAZ, 24.1.2003
Weltsozialforum zieht nach Indien
Gegen den erklärten Willen der lateinamerikanischen OrganisatorInnen beschloss die Führung, das globalisierungskritische Meeting 2004 erstmals in Indien abzuhalten - TAZ 25.1.2003
"Das ist ein enormer Schritt nach vorn"
2004 findet das Forum in Indien statt. Der Sozialforscher Samir Amin wertet diese Entscheidung als Aufbruchsignal - TAZ 25.1.2003
Die Welt ist ein Warenhaus
Bei der Eröffnungsdemo des Weltsozialgipfels tummeln sich unendlich viele Gruppen. Einig sind sie sich in ihrer Sorge über einen drohenden Irakkrieg - TAZ 25.1.2003
Globalisierung ist nicht geschlechtsneutral
Wenn es um feministische Denkansätze geht, unterscheidet sich Porto Alegre nicht wesentlich von konventionellen politischen Orten. In den globalisierungskritischen Bewegungen geben alt- und neulinke Männer den Ton an - TAZ, 27.1.2003
Gemeinsam gegen Steuerflucht
Weltsozialforum in Porto Alegre dient auch der "Vernetzung" von Gruppen zum selben Thema. Steuerkonkurrenz kostet arme Länder mehr, als die Entwicklungshilfe bringt - TAZ, 27.1.2003
Vernetzung gegen einen Krieg im Irak
Auf dem Weltsozialforum in Porto Alegre gründen Friedensgruppen ein globales Widerstandsnetzwerk - TAZ, 27.1.2003
"Ich habe nie Distanz gewahrt"
Interview mit dem berühmten Fotografen Sebastião Salgado - TAZ, 28.1.2003
Salam alaikum in Porto Alegre - TAZ, 29.1.2003
Eine neue Welt, bitte!
Mit einem Aufruf zum Kampf für eine gerechtere Weltordnung endete das 3. Weltsozialforum in Porto Alegre. 30.000 Menschen demonstrieren bei der Schlussveranstaltung gegen den Irakkrieg - TAZ, 29.1.2003
WELTSOZIALFORUM IN PORTO ALEGRE
Das Weltsozialforum in Brasilien ist zu Ende. Die Abschlusserklärung "Brief von Porto Alegre" ist ein schnörkelloser Appell gegen einen drohenden Irakkrieg und für Frieden und globale Gerechtigkeit. Die 100.000 Teilnehmer nehmen vor allem Inspirationen für ihre politische Arbeit mit nach Hause - TAZ, 29.1.2003
Protest und Polemik
Zum Schluss schlägt in Porto Alegre die Stunde der Promis: Venezuelas Präsident Chávez verspricht die Tobin-Steuer - TAZ, 29.1.2003
PORTO ALEGRE HAT SICH ETABLIERT - UND WIRD IMMER MEHR WIE DAVOS
Die Wir-Seligkeit reicht nicht mehr
TAZ 23.1.2003
2.000 hier - 100.000 dort
Die Foren in Davos und Porto Alegre
Zum 33. Mal versammeln sich ab heute Vertreter aus Politik und Unternehmen zum Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos im Schweizer Kanton Graubünden. Unter den mehr als 2.000 ausgewählten Gästen des bis kommenden Dienstag tagenden Forums sind auch US-Außenminister Colin Powell und Brasiliens neuer Präsident Luiz Inácio Lula da Silva. Ebenfalls heute beginnt im südbrasilianischen Porto Alegre das Weltsozialforum (WSF), zu dem die Organisatoren mehr als 100.000 Besucher erwarten. Angemeldet haben sich 29.704 Delegierte von 4.962 Gruppen aus 121 Ländern. Bis zum 28. Januar stehen unter anderem 10 Konferenzen, 31 Panels und 1.710 Workshops auf dem Programm.
TAZ, 23.1.2003
Zwei Orte, zwei Geister
von CHRISTIAN SEMLER
Was unterscheidet eigentlich den "Geist von Davos" von dem Porto Alegres? Eigentlich recht wenig, wenn man den Versicherungen von Klaus Schwab, dem Gründer und Chef des WEF, des Weltwirtschaftsforums, Glauben schenken darf. Hat nicht Schwab selbst, wie er jüngst in einem Interview mit der Weltwoche versicherte, schon 1996 darauf hingewiesen, "dass die Globalisierung ohne soziale, kulturelle und umweltschützerische Komponente langfristig nicht weitergehen kann". Werden zu der diesjährigen Davoser Tagung nicht 200 Vertreter globalisierungskritischer Initiativen und Verbände eingeladen, um dem gemeinsamen Ziel zu dienen: Humanisierung der Weltökonomie? Ist also die Entgegensetzung von "Davos" und "Porto Alegre" nichts als ein Schlagstock, allein dazu geeignet, Emotionen zu schüren und der Linken zu einer billigen Konfrontation mit einem Feind zu verhelfen, der gar nicht existiert?
Die Globalisierungskritiker, die sich bereits im dritten Jahr, zeitgleich mit Davos, massenhaft wie noch nie in Porto Alegre versammeln werden, sehen die Sache naturgemäß anders. Antonio Martins von Attac Brasilien hält das Davoser Forum nach wie vor für eine Wegbereiterin der Deregulierung und des Sozialabbaus im Weltmaßstab. Dass die Globalisierungsfürsten in Management und Politik ihr Herz für die sozialen und ökologischen Weltprobleme entdeckt hätten, ist für ihn bloße Rhetorik, Begleitmusik bei der fortlaufenden Liberalisierung der Märkte.
30.000 Franken Eintrittsgeld
Tatsächlich bestehen, was den Charakter der Foren, das Selbstverständnis wie die Selbstdarstellung der Akteure, die Herangehensweise an die Probleme und die Methodik der Lösungswege angeht, zwischen beiden Versammlungen grundlegende Unterschiede. Natürlich muss man auf der Hut sein, wenn man sie charakterisiert, muss allzu billige Schemata vermeiden. Porto Alegre steht nicht für die Elendsquartiere der Dritten Welt, so wenig wie Davos heute noch ein Ort exklusiver Vergnügungen ist. Und Porto Alegre ist weit davon entfernt, als Beratungs- und Organisationszentrum der weltweiten Habenichtse zu funktionieren. Ebenso wenig kann Herr Schwab und sein Davoser Unternehmen für sich in Anspruch nehmen, den Globalisierungsprozess mit irgendwelchen nennenswerten intellektuellen Impulsen zu pushen.
Dies vorausgesetzt, soll die erste der wichtigen Differenzen beider Versammlungen benannt werden: geschlossen die eine, offen die andere. Die Eintrittskarte nach Davos ist schwer zu erlangen und kostet nicht wenig - Mitglieder zahlen 30.000 Franken pro Jahr plus zwischen 10.000 und 30.000 Franken Teilnahmegebühr. Nicht jeder, der anklopft, wird eingeladen. Für Porto Alegre gilt: Wer die Reisekosten aufbringt, ist willkommen. Alle Veranstaltungen stehen dem Publikum offen. In Davos schaltet frei der Guru Schwab, in Porto Alegre müht sich ein Organisationskomitee aus Initiativen und NGOs, das Chaos zu meistern. Davos legt seinen Ehrgeiz darein, sich mit Berühmtheiten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zu schmücken. Auch in Porto Alegre wünscht man sich die Präsenz der prominenten Globalisierungskritiker. Man liebt und verehrt sie, misstraut ihnen aber gleichzeitig. Werden sie nicht zu viel Aufmerksamkeit auf sich und von der guten Sache abziehen? Denn für jeden Linken gilt immer noch, dass die Völker respektive die Massen entscheiden und nicht die herausragenden Individuen.
Warum lieben die Linken Massenveranstaltungen, während es die Mächtigen und Möchtegern-Machthaber eher mit geschlossenen Klubs halten? Für Letztere ist die Erklärung einfach. Sie sind überzeugt davon, dass ihr Platz an den Schalthebeln berechtigt ist, quasi eine Naturtatsache. Die Sprache Schwabs ist hier instruktiv. Er spricht stets nur von "leadern", ob es sich nun um Geistliche, Medienleute, Ökonomen oder Politiker handelt. Denn es sind nun mal die Leader, die die Geschicke der Welt bestimmen.
Leader lieben Leader
Außerdem dient die geschlossene Gesellschaft als Clearingstelle, als Ort diskreter Beratungen und Absprachen. Bevor sich Davos zum Zentrum der Erklärung ökonomischer Welträtsel ernannte, war die informelle Absprache zwischen Politikern und Wirtschafslenkern sogar der einzige deklarierte Daseinszweck des Forums. Leader lieben Leader, ungeachtet scharfer Konkurrenz und neidischer Seitenblicke potenzieren sie gegenseitig ihr Gefühl der Bedeutsamkeit.
Obwohl die praktischen Resultate von Davos in krassem Gegensatz zum Selbstbild der Teilnehmer stehen, kann dieses Selbstbild doch auf starke Resonanz seitens des Publikums rechnen. Ein wahrer Pfingstglaube verführt die Öffentlichkeit, an den Erfolg von runden oder ovalen Tischen zu glauben, an denen die Elite, also die Politiker, Unternehmer, Vertreter diverser Einflussgruppen und professionelle Denker Platz genommen haben. Dann zählt plötzlich nicht mehr der Gegensatz der Interessen, sondern die harmonische Anstrengung im Dienst des Gemeinwohls, Davos - der Ort müsste nach dem Geschmack des Bundeskanzlers sein.
Hierzu also im Gegensatz: Die Linken lieben Massenbewegungen und Massenveranstaltungen, natürlich nur ihre eigenen, dies aus gutem Grund. Thomas Mastnak, slowenischer Soziologe und Friedensaktivist, antwortete einmal auf die Frage, ob fortschrittliche Massenbewegungen denken können, ohne zu zögern: "Ja!" Er setzte hinzu: "Und sie freuen sich". Sie, die häufig vor Ort als Minderheit agieren, freuen sich ihrer großen Zahl. Sie freuen sich auch am Gewimmel, an der Vielzahl oft divergierender Gruppierungen, der Buntscheckigkeit, die nur durch ein einziges Bedürfnis zusammengehalten wird: den Durst nach Gerechtigkeit.
Aber wieso können linke Massenbewegungen denken? Ist es nicht so, dass, wer in die Massen eintaucht, sein reflektierendes Ich abgibt, eintritt ins Reich, wo das Unbewusste waltet, wo die Libido sich dem Führer der Massenbewegung zuwendet? Sind es nicht stets zweifelhafte, der Vernunft verschlossene Energien, die sich in den Massen Bahn brechen? Müsste Antonio Martins, der erwähnte brasilianische Attac-Aktivist, nicht zu des Altmeisters "Massenpsychologie und Ich-Analyse" greifen, ehe er im Interview sagen könnte: "Als Brasilianer wissen wir um die Rolle großer Feste als Katalysatoren latenter Energien." Und wäre es hier nicht angemessener, mit Elias Canetti, dem Autor von "Masse und Macht", von "Festmeuten" zu sprechen?
All diese pessimistischen Einschätzungen setzen voraus, dass, wo Massen versammelt sind, die Individualität ausgelöscht wird. Aber das trifft nur für Versammlungen zu, die diese Auslöschung inszenieren, wo die versammelten Menschen wie Herden behandelt werden, die ihrem Herdentrieb freien Lauf lassen sollen. Aber gerade die Beobachtung sehr großer linker Massenversammlungen, Demonstrationen und Feste seit den 60er-Jahren zeigt uns, dass beides zusammengehen kann: durchgehaltene Individualität, Vielfalt der Einzel- und Gruppenidentitäten und jenes "ozeanische" Gefühl, von dem alle als Teilnehmer der "Masse" ergriffen werden. Die entfesselten Energien, von denen Antonio Martins sprach, sie übersetzen sich in die Sprache der politischen Vernunft, die allerdings viele Zungen hat. Dies setzt freilich voraus, dass die Linken nicht ein weiteres Mal der Versuchung erliegen, sich als programmatische "Weltpartei" zu fühlen, wenn sie es aufgeben, im Gleichklang zu singen und im Gleichschritt zu marschieren, wenn sie den Sargdeckel fest auf dem Grabmal des Führerkults halten.
Nirgends lässt sich die Differenz zwischen Davos und Porto Alegre sinnfälliger fassen als in den Formen, in denen jeweils die demokratische Willensbildung ablaufen soll. In Davos herrscht die Politik der verschlossenen Tür, mag Schwab das noch so entschieden bestreiten. Die Macher des WEF wählten die Doppelrolle des Moderators und Politikberaters. Mittlerweile wird es ihnen in dieser Doppelrolle etwas ungemütlich, beruhte ihr Rat doch allzu häufig auf falschen Annahmen und Fehlprognosen, zum Beispiel hinsichtlich des Siegeszuges der "New Economy". Jetzt sehen sie sich in der Rolle des Inspirators, wollen modellhaft weltweite medizinische Projekte oder soziale Selbstverpflichtungen von Firmen für die Produktion in der Dritten Welt in Gang bringen. In der Theorie gescheitert, setzen sie auf beispielhafte Praxis. Eine Fluchtbewegung. Geblieben aber ist das elitäre Selbstverständnis, die Selbstbespiegelung als Avantgarde der kapitalistischen Reform.
Partizipation braucht Zeit
In Porto Alegre hingegen herrscht der Geist der Selbsttätigkeit und der Partizipation. Vielfach haben in der jüngsten Vergangenheit, in der Anti-AKW- wie in der Friedensbewegung Massenversammlungen den Beweis erbracht, dass Selbstorganisation, demokratische Verfahren und sogar vernünftige Beschlüsse möglich sind. Es dauert nur etwas länger und strapaziert stärker die Nerven. Aus diesem Grund ist die Ankündigung, man werde sich diesmal in Porto Alegre auf ein Aktionsprogramm, vielleicht sogar auf ein paar ständige Institutionen einigen, nicht von vornherein als Zeichen der Bürokratisierung, der Erstarrung und des Niedergangs zu lesen. Leute mit dem Davos-Blick werden es schwer haben, sich in Porto Alegre durchzusetzen. Und umgekehrt.
TAZ, 23.1.2003
Offene und geschlossene Kreise
von GERHARD DILGER
Auf den Gängen der Katholischen Universität im brasilianischen Porto Alegre übersieht man ihn fast. Auch wenn er leise über die "ethische Verpflichtung der Unternehmer" referiert, zieht der graubärtige Mann seine Zuhörer kaum in den Bann. Aber wenn Oded Grajew (58) von den Anfängen des Weltsozialforums erzählt, bekommt er leuchtende Augen.
"Als im Januar 2000 das Weltwirtschaftsforum in Davos stattfand, dachte ich mir, eigentlich müsste man eine Gegenveranstaltung auf die Beine stellen, bei der soziale Fragen im Vordergrund stehen", sagt der frühere Spielzeugunternehmer und Begründer der Unternehmerorganisation "Ethos". Er fuhr nach Paris, zu Bernard Cassen, dem Generaldirektor von Le Monde diplomatique und Vorsitzenden von Attac Frankreich. "Cassen war begeistert und schlug als Tagungsort Porto Alegre vor, wo er kurz zuvor den Bürgerhaushalt der Arbeiterpartei PT kennen gelernt hatte", erinnert sich Grajew. Ein Jahr darauf war es so weit: 15.000 GlobalisierungskritikerInnen, vorwiegend aus Lateinamerika, Frankreich und Italien, pilgerten nach Porto Alegre.
Eine gelungene Attacke
Nach dem "Intergalaktischen Treffen gegen den Neoliberalismus" der Zapatisten 1996 und den Protesten von Seattle Ende 1999 wurde das Weltsozialforum zum Symbol für das Streben nach einer "anderen Welt" jenseits der Warenlogik. Selbst die Financial Times schrieb wenig später von einer gelungenen "Attacke auf den Planeten Davos". Im vergangenen Jahr waren es dann schon 50.000 Menschen, die in den südbrasilianischen Hochsommer reisten, in diesen Tagen werden doppelt so viele Delegierte erwartet.
Wegen der Wahlkämpfe und Regierungswechsel der letzten Monate wird vieles buchstäblich in letzter Sekunde auf die Beine gestellt. Hunderte Helfer kommen ins Schwitzen, das gedruckte Programm gibt es erst morgen, denn die Tagesordnung wurde noch bis gestern Nacht verhandelt. Lediglich die Themenschwerpunkte stehen fest: Nachhaltigkeit, Menschenrechte, globalisierte Kultur, Zivilgesellschaft und Friedensarbeit. Auf den Podien werden unter anderen Prominente wie die US-Schauspielerin Susan Sarandon, die indische Philosophin Radha Kumar, der amerikanische Politologe Noam Chomsky oder auch die iranische Regisseurin Samira Makhmalbaf sitzen.
Wie es nach dem Megaevent weitergehen soll, diskutierten bis gestern Abend die Mitglieder des Internationalen Rates, mit mittlerweile über 100 Organisationen aus aller Welt das höchste Gremium des Weltsozialforums. In seinem Selbstverständnis ist das Forum ein "offener Raum", in einem "andauernder Prozess der Entwicklung von Alternativen" begriffen, wie es in den WSF-Prinzipien heißt. Unter diesem breiten Schirm haben viele Platz: Altlinke, Menschenrechtler, NGO-Lobbyisten, soziale Bewegungen, Gewerkschaften, Ökologen, Anarchisten, Entwicklungspolitiker, Christen und Anarchisten. Zum "Geist von Porto Alegre" gehört, dass man Differenzen behutsam oder oft gar nicht austrägt - einen "unausgesprochenen Nichtangriffspakt" nennt das Manuel Monereo von der spanischen Vereinigten Linken. Deshalb gibt es auch prinzipiell keine offizielle Abschlusserklärung.
Debatte der weißen Männer
Die alljährlich verabschiedeten "Mobilisierungsaufrufe der sozialen Bewegungen" bestehen in einer Aufzählung der Übel dieser Welt, gegen die man angehen will: Neoliberalismus, imperialistische Kriege, Verschuldungskrise, Umweltzerstörung. Die Aktivisten reproduzieren die Diskursmuster aus ihren Szenen und Heimatregionen. Über die antikapitalistische Ausrichtung herrscht in Lateinamerika zumindest auf der rhetorischen Ebene Konsens: US-Aktivisten kritisieren die "von den Multis angetriebene Globalisierung", Umweltschützer fordern eine "nachhaltige Entwicklung", Kleinbauernverbände "Ernährungssicherheit".
Von meist weißen älteren Männern wird die aktuelle Strategiedebatte dominiert. Die "große Frage des kommenden Jahrzehnts" sieht etwa der US-Historiker Immanuel Wallerstein darin, "ob das Weltsozialforum sich auf eine klareres, positives Programm zubewegen kann", ohne dabei auf eine "notwendigerweise hierarchische Struktur" zurückzugreifen. Der brasilianische Soziologe Emir Sader wird deutlicher: "Bisher ist es uns nicht gelungen, unsere Stärken in eine politische Kraft umzusetzen, durch die die herrschende neoliberale Politik effektiv behindert werden kann."
von KATHARINA KOUFEN
Es hat sie schon gegeben, die historischen Momente, da blickte die ganze Welt auf den schweizer Bergort Davos. Zum Beispiel 1992, als Nelson Mandela und der südafrikanische Apartheidspräsident Frederik de Klerk sich auf dem Weltwirtschaftsforum trafen. Oder 1994: Arafat und Peres reichen sich vor verschneiter Alpenkulisse die Hände. Auf solche politischen Highlights verweist Klaus Schwab (64), Präsident des Weltwirtschaftsforums, wenn er nach der politischen Bedeutung "seines" Forums gefragt wird.
Imageverlust der Bosse
Keine Frage, der Mann ist mächtig stolz auf das, was er vor 32 Jahren ins Leben gerufen hat. Damals als informelles Managertreffen gedacht, ist Davos heute ein hochkarätig besetztes Weltereignis. Rund 2.000 Gäste erwartet der gebürtige Schwabe in diesem Jahr: Manager, Politiker und Medienbosse. Doch die politische Bedeutung, die Schwab seinem Forum zuschreibt, ist nicht für alle Teilnehmer nachvollziehbar. "In letzter Zeit hatten die Treffen keine große politische Signalwirkung mehr", meint etwa Christoph Rabe, Wirtschaftskorrespondent beim Handelsblatt.
Das hat mehrere Gründe: Zum einen haben sich die Foren seit Mitte der 90er-Jahre durch eine permanente Fehleinschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung diskreditiert. 1997 zum Beispiel brach die Asienkrise aus - und keiner der Davoser Wirtschaftsexperten hat davor gewarnt. 1999 jubelte man über einen starken Euro - und die neue Währung geriet prompt in einen Abwärtstrend, der mehr als zwei Jahre anhalten sollte. Im Jahr 2000 wurde gar eine "Transformation der globalen Wirtschaft durch die New Economy" vorhergesagt - eine glatte Fehleinschätzung, wie sich bald herausstellte.
Zum anderen hat die Unternehmerschaft einen Imageverlust erlitten. Stars von gestern outeten sich als Betrüger - wie EM-TV-Chef Thomas Haffa und Percy Barnevik von ABB. Oder Kenneth Lay, der ehemalige Chef des US-Energieriesen Enron. Ausgerechnet er hielt noch vor zwei Jahren eine Rede über "die Bedeutung der Geschäftsbeziehungen". Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft: Er hat seine Geschäftsbeziehungen gründlich missbraucht.
Und schließlich ist das elitäre Forum in den letzten Jahren in die Kritik geraten, weil es für prätentiös formulierte Themen nichts zu bieten hatte als banale, unverbindlich formulierte Lösungen. Tatsächlich drängt sich die Frage auf, was die 2.000 Teilnehmer in ihren mehr als 250 Workshops, Podiumsdiskussionen und Abendessen eigentlich machen, wenn am Schluss Ergebnisse wie in den Vorjahren herauskommen wie: "Erziehung hilft als Schlüssel für mehr Bewusstsein" als Antwort auf die "Herausforderungen an eine neue Generation".
Dieses Jahr steht Davos unter dem Motto "Vertrauen bilden". Angesichts prominenter Gäste wie US-Außenminister Colin Powell und Brasiliens Präsident Lula da Silva ist das Vertrauen in deren Sicherheit gering: Das Treffen findet unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt.
Die Davos-Euphorie hat sich etwa zeitgleich mit der allgemeinen Wirtschafts-, Finanz- und Börseneuphorie entwickelt. "Ende der 90er-Jahre hieß es in Davos immer wieder, die Politik hinke der Wirtschaft meilenweit hinterher", erinnert sich Rabe. "Damals war alles, was mit Wirtschaft, Finanzen und Aktien zu tun hatte, en vogue - und das Treffen wurde zum großen Medienspektakel." Dass Davos auch ein "Forum für die Selbstdarstellung seiner Teilnehmer geworden ist", moniert Markus Mugglin vom Schweizer Radio DRS.
Davos - einer reines PR-Event? Nein, protestiert nicht nur Klaus Schwab, auch wenn er sich ohne die 400 Medienvertreter "wohler fühlen" würde, wie er kürzlich in einem Interview zugab. Schwab verweist aber neben den politische Highlights auch auf die unentbehrlichen Kontakte, die auf seinem Treffen entstehen. "Networking" heißt das offiziell, man könnte es auch "Klüngel" nennen.
Themenkatalysator Davos
Nein, sagt auch Paul Spahn, Wirtschaftsprofessor in Frankfurt, der 2002 zur Vorbereitung des Forums nach Davos geladen war. "Davos ist hervorragend geeignet, bestimmte Themen loszutreten." Und das funktioniert so: Im Vorfeld des Treffens werden Experten nach Davos geladen. Dort wird diskutiert, ob das Thema schon reif ist. Wenn ja, "wird einer ausgesucht, der das in seiner Rede dann anspricht", erklärt Spahn.
So geschah es im letzten Jahr mit dem Appell von UN-Generalsekretär Kofi Annan, die reichen Länder sollten ihre Entwicklungshilfe verdoppeln. Spahn war 2002 zum Thema Tobin-Steuer befragt worden, doch die wurde für "noch nicht reif" befunden. "Davos hätte sich nur blamiert", meint Spahn. Dafür wären Herr Schwab und seine Leute mit Sicherheit um einen historischen Moment reicher geworden.
TAZ, 24.1.2003
Weltsozialforum zieht nach Indien
Gegen den erklärten Willen der lateinamerikanischen OrganisatorInnen beschloss die Führung, das globalisierungskritische Meeting 2004 erstmals in Indien abzuhalten
Von Gerhard Dilger
Die zentrale interne Entscheidung des diesjährigen Weltsozialforums ist gefallen: Genau in einem Jahr findet die wichtigste Großveranstaltung der globalisierungskritischen Bewegung nicht mehr im brasilianischen Porto Alegre statt, sondern in Indien. Dazu hat sich der Internationale Rat, das höchste Gremium des Forums, noch vor der offiziellen Eröffnungsveranstaltung durchgerungen.
Am Ende der zweitägigen Sitzung am Mittwochabend traten die grundlegenden Differenzen innerhalb des Führungspersonals der Bewegung so deutlich zutage wie noch nie. Auf der einen Seite standen die meisten Vertretern aus Lateinamerika und die Mehrheit des achtköpfigen brasilianischen Organisationskomitees, das seit Ende 2000 die Großveranstaltung in Porto Alegre organisiert und dieses De-facto-Monopol gerne behalten hätte. Auf der anderen Seite plädierten sämtliche Redner aus Afrika und Asien dafür, dass die immer wieder beschworene "Internationalisierung" des Prozesses sich auch im Austragungsort niederschlagen müsse.
Diese Konstellation war nicht ganz neu. Bereits vor Jahresfrist hatten indische Organisationen angeboten, das dritte Weltsozialforum bei sich auszurichten. Damals beschloss der Rat, erneut an der bewährten Lösung Porto Alegre festzuhalten, und empfahl den Indern, als Probelauf erst einmal ein Regionaltreffen auf die Beine zu stellen.
Nun fand das Asiatische Sozialforum vor drei Wochen mit großem Erfolg im indischen Hyderabad statt (die taz berichtete). Nur: Die wenigsten lateinamerikanischen AktivistInnen bekamen davon etwas mit. Und ihre eigene Agenda, vor allem der Widerstand gegen die gesamtamerikanische Freihandelszone von Alaska bis Feuerland, ist ihnen wichtiger als die Vernetzung mit der gegenüberliegenden Seite des Globus.
Aber so etwas darf man natürlich nicht laut sagen. Daher verlegten sich die Vertreter des Status quo auf eine recht scheinheilige Argumentation: Natürlich habe niemand etwas gegen Indien, doch aus "technischen, nicht politischen Gründen" sei es angebracht, kommendes Jahr überall Regionalforen anzusetzen, in Indien etwa ein "afrikanisch-asiatisches". 2005 stehe Porto Alegre wieder als Tagungsort für das Weltsozialforum bereit.
Auf diesen faulen Kompromiss wollten sich die zahlenmäßig klar unterlegenen Afrikaner und Asiaten nicht einlassen. Schließlich hatte Diskussionsleiter Francisco Whitaker vom brasilianischen Organisationskomitee ein Einsehen und band auch die hartnäckigen Kubaner ein, die den Beschluss "wegen des fehlenden Konsenses" vertagen wollten. Per Akklamation bekam Indien den Zuschlag - Porto Alegre ist 2005 wieder dran.
"Es war eine schwierige Geburt", sagte Nicola Bullard vom thailändischen Thinktank "Focus on the Global South". Das "fantastische Ergebnis" werde in Asien "Begeisterung auslösen und neue Energien freimachen". Die Inderin Meena Menos vom Asiatischen Sozialforum freute sich gegenüber der taz über den "Riesenschritt von der derzeitigen Dominanz westlich orientierter weißer Männer hin zu einem wirklich pluralistischen Prozess".
"Wir wollen unsere Vielfalt feiern, unsere unterschiedlichen Ideen und Weltanschauungen - nur so macht doch Politik Spaß", meinte Meena Menos und berichtete: "Als ich das zu einem Kollegen aus Lateinamerika gesagt habe, war seine Antwort: Ich würde nicht so weit gegen, die Unterschiede zu feiern, aber ich werde sie tolerieren."
TAZ, 25.1.2003
"Das ist ein enormer Schritt nach vorn"
2004 findet das Forum in Indien statt. Der Sozialforscher Samir Amin wertet diese Entscheidung als Aufbruchsignal
INTERVIEW: GERHARD DILGER
taz: Herr Amin, der Internationale Rat, das höchste Gremium des Weltsozialforums, hat beschlossen, das Forum 2004 in Indien abzuhalten. Wie bewerten Sie das?
Samir Amin: Das ist ein enormer Schritt nach vorn. Das Weltsozialforum muss seinem Namen gerecht werden, also Volksbewegungen aus aller Welt integrieren. Das ist schwierig, wenn man immer am gleichen Ort tagt. Aus pragmatischen Gründen sind wir jetzt bereits zum dritten Mal in Porto Alegre, und nach wie vor überwiegen die Teilnehmer aus Amerika und Europa. Nun wird endlich vielen anderen Bewegungen die Teilnahme ermöglicht.
Was bedeutet das für die Bewegung in Indien?
Sie wird stärker. Vor zwei Wochen war ich auf dem Asiatischen Sozialforum, es war genauso eindrucksvoll wie Porto Alegre. Allein aus Indien waren 1.000 Gruppen und unendlich viele Aktivisten vertreten.
Wird es dadurch einfacher, die bisher praktisch abwesenden Globalisierungskritiker aus der arabischen Welt oder China zu integrieren?
Ja, Araber und Chinesen werden bestimmt in großer Anzahl kommen.
Welchen politischen Zusammenhang sehen Sie zum drohenden Irakkrieg in dieser strategisch wichtigen Weltregion?
Wir haben es mit einer Serie imperialistischer Kriege der Vereinigten Staaten zu tun, Kriegen, die unilateral in Washington beschlossen werden. Zentralasien und der Nahe Osten wurden aus mehreren Gründen für die ersten Schläge ausgewählt: Über Marionettenregimes wollen die USA sich die ausschließliche Kontrolle über das Öl sichern. Und auf ihre Verbündeten in Europa und Japan üben sie Druck aus, um deren relativ eigenständige Außenpolitik zu unterbinden. Von den geplanten US-Militärbasen könnten sie Ziele in Afrika, Asien und im Nahen Osten erreichen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass das Weltsozialforum ebenfalls in dieser Großregion stattfindet. Denn wir müssen uns gegen die US-Strategie wenden, die militärische Kontrolle über die ganze Welt zu erringen. Nur dann können wir auch der wirtschaftlichen Globalisierung widerstehen.
TAZ, 25.1.2003
Die Welt ist ein Warenhaus
Bei der Eröffnungsdemo des Weltsozialgipfels tummeln sich unendlich viele Gruppen. Einig sind sie sich in ihrer Sorge über einen drohenden Irakkrieg
aus Porto Alegre von KATHARINA KOUFEN und GERHARD DILGER
Der schwarze Filzstift macht sich gut auf der braunen Haut. "Ich bin nicht zu verkaufen", schreibt Jorge sich mit der rechten Hand au den linken Arm. "I am not for sale", auf Englisch, damit es auch die vielen Ausländer hier in Porto Alegre verstehen. Sein Freund José macht es genauso. Zwei junge Brasilianerinnen schauen zu den beiden hin, mustern die muskulösen Oberarme und grinsen. Jorge lächelt schüchtern zurück. Nein, das ist keine plumpe Anmache. Er ist aus Chile zum Weltsozialforum nach Brasilien gereist und hat nur den Slogan von Attac, "Die Welt ist keine Ware", ein bisschen abgeändert.
Die Welt ist keine Ware, sondern ein Warenhaus mit vielen unterschiedlichen Abteilungen. Zumindest hier im sommerlichen Porto, wo am Donnerstag das dritte Weltsozialforum begonnen hat - die Gegenveranstaltung zum Weltwirtschaftsforum in Davos. 70.000 Menschen aus 130 Ländern zogen zur Eröffnung des Massentreffens durch die Straßen. Alle protestierten auf ihre Weise gegen die neoliberale Globalisierung. "Wir arbeiten nicht für Profite, sondern für die Würde der Menschen", fasst die Anti-Weltbank-Aktivistin Njoki Njehu aus Kenia zusammen.
Vor allem: laut
Ganz vorn im Demonstrationszug fährt eine Art Karnevalswagen mit einer Horde aufgekratzter brasilianischer Gewerkschaftsjugendlicher. Weiter hinten ein Transparent: "Eine andere Welt ist möglich." Zwei, drei deutsche Mitmarschierer skandieren "Bleiberecht für alle" und "Ob Ost, ob West, nieder mit der Nazipest". Aber weil die Venezolaner vor ihnen viel lauter "Cha-Cha-Chávez" in Solidarität mit ihrem streikgebeutelten Präsidenten fordern, und weil auch die Gruppe aus Argentinien hinter ihnen entschlossen "Ich möchte in meinem Land keine IWF-Yankees mehr sehen" ruft, verstummt der deutsche Sprechchor wieder.
Besonders lautstark gebärdet sich die linke Splittergruppe "Vereinigte Sozialistische Arbeiterpartei" aus Brasilien: "Lula, lass es geschehn / ein Referendum wolln wir sehn / Alca soll jetzt zum Teufel gehn" rufen hunderte zu aufpeitschenden Trommelklängen. Alca, das ist die Abkürzung für die gesamtamerikanische Freihandelszone und der Inbegriff des nordamerikanischen Hegemonialstrebens auf dem Kontinent.
Von "Rettet den Planeten" über "Gegen die Diskriminierung von Homosexuellen" bis hin zum "Recht auf Abtreibung" sind so ziemlich alle Forderungen vertreten, die jemals auf einer Demo erhoben wurden. Dominierendes Thema aber sind der drohende Irakkrieg und der gemeinsame Hauptfeind, der amerikanische Präsident George W. Bush.
Die Schärfe des Protests reicht von "Brot statt Kanonen" bis hin zu Transparenten mit "Bush gleich Hitler? Nein, Bush ist schlimmer", wie eine "Volksdelegation" aus dem brasilianischen Nordosten hetzt. In Lateinamerika ist "Hitler" nicht mehr als ein beliebiges Synomym für "böse". Einige deutsche Demonstranten schauen trotzdem peinlich berührt drein - auch wegen der extrem israelfeindlichen Transparente, die allerdings nur ganz vereinzelt zu sehen sind.
"Das ist politisch"
Vor allem die Journalisten interessieren sich für derlei Polemik - nur vom harmonischen Marschieren zu berichten ist schließlich langweilig. Kurzzeitig scheint auch ein Grüppchen von Muslimen für eine Kontroverse zu taugen - doch dann stellt sich heraus, dass die zehn bärtigen Männer und die Frauen mit Kopftüchern und "Der Islam ist die Lösung"-Transparenten Studenten der Islamwissenschaft sind und keine eigens eingeflogenen Bin-Laden-Sympathisanten.
Porto Alegre - ein durchgeknallter Karnevalszug? "Nein", findet SPD-Mitglied Detlev von Larcher, der mit Attac-Fähnchen neben dem Zug herläuft. "Das hier ist ganz und gar politsch. Die jungen Leute haben heute eben ganz andere Ausdrucksformen als damals die 68er."
Die Bewohner der Zweimillionenstadt lehnen aus den Fenstern, stehen auf dem Balkon oder sitzen in den Cafés. "Guck mal", sagt ein kleines Mädchen zu seiner Mama, "warum malt sich der Mann da seinen Arm an?"
TAZ, 25.1.2003
Globalisierung ist nicht geschlechtsneutral
Wenn es um feministische Denkansätze geht, unterscheidet sich Porto Alegre nicht wesentlich von konventionellen politischen Orten. In den globalisierungskritischen Bewegungen geben alt- und neulinke Männer den Ton an
von CHRISTA WICHTERICH
Bene Madunagu, Koordinatorin des Süd-Frauen-Netzwerks Dawn für das anglophone Afrika, spurtete beim Afrikanischen Sozialforum in Addis Abeba Anfang Januar von einem Podium zum anderen. "Egal, ob es um Kultur, Frieden, Informationstechnologien oder Landwirtschaft ging - überall taten die Redner, als sei Globalisierung geschlechtsneutral. Frauen kommen bestenfalls als Armenmasse vor." Es geht der Nigerianerin nicht darum, Frauen oder das Thema Geschlechterdemokratie dem Spektrum der Globalisierungskritik als Opferelement hinzuzufügen. Sie will feministische Konzepte einbringen.
"In diesem Jahr müssen wir eine kritische Masse aufbauen", so die Organisatorinnen von Frauenveranstaltungen beim Weltsozialforum in Porto Alegre. Kaum zu glauben: Geht es um feministische Ansätze, unterscheidet sich Porto Alegre kaum von konventionellen politischen Orten. In den globalisierungskritischen Bewegungen geben wieder einmal alt- und neulinke Männer den Ton an. Und im Diskurs von Porto Alegre bleiben feministische Perspektiven randständig.
An Perspektiven haben Frauenorganisationen heftig gearbeitet, seit sie bei der Weltfrauenkonferenz 1995 in Peking Frauenrechte durch zwei erstarkende Kräfte bedroht sahen: den Neoliberalismus und den Fundamentalismus. Beides bezogen sie in ihre Globalisierungskritik ein: die konzerngesteuerten Profitregime und ihre Kehrseite, politische und religiöse Fundamentalismen als Gegenwehr und Selbsthauptung gegen die neoliberale Vorherrschaft.
Gleichzeitig fand eine "Globalisierung von unten" statt, eine transnationale Vernetzung von Basisorganisationen aus dem gewerkschaftlichen, bäuerlichen und Friedensmilieu. Sie streiten für existenzsichernde Löhne, kämpfen gegen die Patentierung von Saatgut und wenden sich gegen die Verlagerung sozialer Leistungen in die privaten Haushalte, sprich: in die unbezahlte Arbeit von Frauen.
Frauenorganisationen müssen ihre Konzepte und Kämpfe neu orientieren - so lautete das Fazit der Konferenz "Globalisierung neu erfinden", die das nordamerikanische Netzwerk Awid vergangenen Oktober in Mexiko organisierte. Da diskutierte die intellektuelle Bewegungselite (Teilnahmegebühr 250 US-Dollar) über eine Globalisierung wirtschaftlicher und sozialer Rechte gegen den ökonomischen Fundamentalismus, attackierte die neue politische und militärische Hegemonie und betonte die Notwendigkeit, die Unterschiede und multiplen Identitäten von Frauen zu berücksichtigen.
Schon beim Asiatischen Sozialforum in Hyderabad Anfang Januar veranstalteten Frauenorganisationen ein eigenes Plenum, weil sie sich auf den gemischten Podien nicht ausreichend vertreten fanden. Unter dem Motto "Frauen leisten Widerstand gegen die Globalisierung" konkretisierten sie die zwei Aufgaben: Widerstand gegen Neoliberalismus, Militarisierung und Fundamentalismen zu leisten und Alternativen zu entwerfen.
Voraussetzung ist in jedem Fall eine radikale Demokratisierung von Politik, Ökonomie und Kultur, in der Frauen ihre bürgerschaftliche Handlungsfähigkeit realisieren. Nur unter der Bedingung einer partizipativen Demokratie von unten sind Umverteilungsgerechtigkeit, soziale Sicherheit, aber auch Toleranz gegenüber ethnischer, religiöser und kultureller Vielfalt denkbar.
Auf diesem Hintergrund fordert Bene Madunagu eine "Reradikalisierung" der Frauenbewegungen: "Wir müssen weg vom derzeitigen NGO-Stil, der durch Lobbying und fast schon unterwürfiges Bitten und Betteln beim Staat und den männerdominierten politischen Strukturen gekennzeichnet ist".
TAZ, 27.1.2003
Gemeinsam gegen Steuerflucht
Weltsozialforum in Porto Alegre dient auch der "Vernetzung" von Gruppen zum selben Thema. Steuerkonkurrenz kostet arme Länder mehr, als die Entwicklungshilfe bringt
von KATHARINA KOUFEN
Man hat sich das ungefähr so vorzustellen: Kapital huscht über den Globus, immer auf der Flucht vor dem Fiskus, immer auf der Suche nach dem angenehmsten Versteck. Steuerflucht ist ein weltweites Problem. Sven Giegold von Attac Deutschland propagiert deshalb auf dem Weltsozialforum in Porto Alegre "die Vernetzung gegen die Steuerflucht". In einem Workshop trafen sich am Wochenende Gruppen aus etwa 10 Ländern, die sich mit diesem Thema befassen.
Das weltweite Problem: Die Steuern auf Unternehmensgewinne und Kapital sinken, während Konsum höher besteuert wird und die Sozialabgaben steigen. Gleichzeit leben immer mehr Menschen von Kapitalanlagen. François Gobbe von Kairos Europe nennt ein Beispiel: In Frankreich nahm der Anteil des Einkommens aus Kapital am gesamten Einkommen in den letzten 25 Jahren von 30 auf 40 Prozent zu. "Was wäre die logische Folge? Kapital höher zu besteuern." Dass die Regierungen das nicht tun werden, ist den meisten Workshop-Teilnehmern bekannt. Denn: "Es herrscht ein ruinöser Wettbewerb zwischen den Ländern, die niedrigsten Steuern zu haben, um möglichst viel Kapital aus dem Ausland anzulocken", so Christian Felber von Attac Österreich.
Und Lucy Komisar, eine Teilnehmerin aus den USA, nennt einen weiteren Grund: Die Politiker profitieren oft selbst von den laxen Steuergesetzen. "Das Unternehmen von US-Vizepräsident Dick Cheney hatte bis zur Wahl 44 Töchter in Steuerparadiesen angemeldet", berichtet Komisar, die als Journalistin viel zu dem Thema recherchiert hat.
Erst letzte Woche haben sich die EU-Minister nach jahrelangem Ringen auf eine europaweite Regelung geeinigt. Doch eine weltweite Einigung, wie sie eigentlich nötig wäre, ist utopisch. Nicht einmal auf dem kleinen Kontinent Europa herrscht Konsens: Einigen Ländern ist ihr Bankgeheimnis wertvoller als die Steuereinnahmen ihrer Nachbarn.
Der Schweiz zum Beispiel. "Die Schweizer sind ganz klar egoistisch", sagt Bruno Gurtner vom Schweizer Verband der Entwicklungsorganisationen. "Und da hat vor allem der Bankenverband seine Hände im Spiel." Die Banken veranstalten regelmäßig Umfragen in der Bevölkerung, "70 Prozent sind demnach immer für das Bankgeheimnis." Banken und Regierung brächten kurz vor solchen Stimmungsbarometern stets ihr Totschlagargument: Das Geschäft mit dem Geld sichere in der Schweiz Arbeitsplätze.
Besonders problematisch: In der Schweiz ist es nicht strafbar, das Steuernbezahlen einfach zu "vergessen". Und solange keine Straftat vorliegt, bleibt das Bankgeheimnis unberührt. Milliardensummen von ausländischen Kapitalflüchtigen, darunter auch von ehemalige Diktatoren aus Afrika und Lateinamerika, lagern daher unbehelligt in der Schweiz - zum Beispiel des ehemaligen Präsidenten Perus, Alberto Fujimori, wie ein peruanischer Workshop-Teilnehmer berichtet.
Was Gurtner besonders erzürnt: Gleichzeitig senken gerade Entwicklungsländer ihre Kapitalsteuern, weil sie dringend auf Geld aus dem Ausland angewiesen sind. "Die multinationalen Konzerne aus den USA haben in den Entwicklungsländern 1996 nur noch halb so viel Steuern wie 1985 gezahlt", zitiert der Schweizer eine Studie der britischen Entwicklungsorganisation Oxfam. Insgesamt entgehen den Entwicklungsländern demnach 50 Milliarden Dollar jährlich durch übermäßige Steuerkonkurrenz und Kapitalflucht. Gurtner: "Das ist so viel wie die gesamte Entwicklungshilfe weltweit."
Die Initiative gegen Steuerflucht will sich in Porto Alegre erst einmal auf gemeinsame Ziele und Wege einigen. Bisher steht fest: "Wir werden zwei Internetseiten mit Informationen anbieten und wir arbeiten an einem Positionspapier mit Vorschlägen zur Bekämpfung der Steuerflucht", so Giegold. Mit dem Papier wollen die Teilnehmer des Workshops auch an Parlamentarier herantreten. In Großbritannien steht sogar schon ein Termin fest: Im März sollen die Forderungen im Parlament vorgestellt werden.
Das Weltsozialforum wuchs von 20.000 Besuchern im Jahr 2001 auf 100.000 derzeit. Fünf Tage treffen sich Aktivisten aus 150 Ländern. Wo die etwa 1.500 Veranstaltungen im Detail zu finden sind, weiß vor ort meist kein Mensch. Gerade die Suche nach dem richtigen Saal führt jedoch oft zu ungewollten, aber informativen Begegnungen.
TAZ, 27.1.2003
Vernetzung gegen einen Krieg im Irak
Auf dem Weltsozialforum in Porto Alegre gründen Friedensgruppen ein globales Widerstandsnetzwerk
von GERHARD DILGER
Junge argentinische Arbeitslosenaktivisten ziehen mit lautem Getrommel und roten Fahnen über den Campus der Katholischen Universität von Porto Alegre. Palästinensische Delegierte bieten elegante Schals feil. Daneben sind Zeitschriften aus Kolumbien und Souvenirs der brasilianischen Arbeiterpartei PT zu erwerben. Tausende drängen von Workshops zu Megakonferenzen, von Treffen mit alten Bekannten zu den Auftritten prominenter Gäste aus Film und Literatur. "Es ist die organisierte Anarchie", sagt Tarik Ali und grinst.
Während auf den 1.700 Workshops die ganze thematische Bandbreite der globalisierungskritischen Bewegung abgedeckt wird, dominiert auf den Großveranstaltungen ein Thema: der drohende Krieg der USA gegen Irak. Ali, pakistanischer Schriftsteller und Linksintellektueller mit Wohnsitz in London, ist einer der Hauptredner zu diesem Thema. Seine Analyse der Unterwerfung der islamischen Welt durch die westlichen Mächte, "Fundamentalismus im Kampf um die Weltordnung", avanciert gerade zu einem neuen Beststeller der Bewegung.
Ali warnt vor Illusionen: Nur eine "neue Intifada" in der arabischen Welt oder die "Isolierung der USA durch Europa" könnte den Irakkrieg noch verhindern, und beides sei unwahrscheinlich. Nur bei einem Antikriegsvotum im britischen Unterhaus würde George W. Bush auf seinen wichtigsten Verbündeten Tony Blair verzichten müssen. Doch der habe sich bereits so sehr festgelegt, dass er in diesem Falle wohl zurücktreten müsse.
"Zum ersten Mal in der Geschichte haben wir es mit einem einzigen, unangefochtenen Imperium zu tun", rief Tarik Ali seinen 10.000 Zuhörern zu. Wenn für die Amerikaner im Nahen Osten alles nach Plan laufe, würden im Anschluss daran andere Regionen "in die Schusslinie" geraten. Der Bewegung stehe ein "langer Kampf" bevor. Auch Brasiliens Präsident, Luiz Inácio Lula da Silva, schnitt das Thema bei seinem umjubelten Auftritt am Freitagabend an: Mit dem Geld, das für Waffen ausgegeben wird, könne der Hunger ausgerottet werden, so Lula. Die Welt brauche keinen Krieg, sondern Frieden und Verständigung.
Lula könne in der Friedensfrage "zu einer wichtigen moralischen Instanz" werden, meint Ali. Letztlich hänge es aber von dem Widerstand in Europa und vor allem in den USA selbst ab, ob der Expansionsdrang Washingtons gebremst werden könne. Ganz in diesem Sinne stellte das "Europäische Antikriegsbündnis" am Samstag seine Planungen für den "europaweiten Aktionstag" am 15. Februar zur Diskussion. Dutzende Teilnehmer beteiligten sich mit eigenen Vorschlägen. Manche hoffen auf Streikaktionen der Gewerkschaften, andere plädieren für "zivilen Ungehorsam". Gleich zwei Delegationen sollen im Februar nach Irak fahren: Die eine wird vom "Europäischen Soziallforum" gebildet, die andere hat sich auf dem Weltparlamentarierforum formiert. Ein Brasilianer ruft seine Landsleute zu "bunten, fantasievollen" Aktionen auf.
Peter Wahl von Attac-Deutschland hofft, dass das Engagement von Schaupielern und Sportlern in den USA den Stimmungsumschwung gegen den Krieg beschleunigen könnte. Am späten Abend einigen sich 50 Aktivisten aus allen Kontinenten auf die Gründung eines "globalen Widerstandsnetzwerks gegen den Krieg" (vorläufige Homepage: www.15februar.de).
Viel mehr als von Erklärungen lebt das Weltsozialforum von der Dynamik derartiger Vernetzungen. So werden nicht nur die Weltregionen stärker miteinander verknüpft, sondern auch Menschen, die zu unterschiedlichen Themen arbeiten. "Immer mehr AktivistInnen wird der Zusammenhang zwischen dem Krieg und der neoliberalen Globalisierung klar" - mit dieser Einschätzung steht Leo Gabriel vom "Europäischen Sozialforum" nicht alleine da.
TAZ, 27.1.2003
"Ich habe nie Distanz gewahrt"
Interview mit dem berühmten Fotografen Sebastião Saldago
Interview von GERHARD DILGER und KATHARINA KOUFEN
taz: Herr Salgado, was hat dieses Foto aus einem Slum in Bombay mit Globalisierungskritik zu tun?
Sebastião Salgado: Alles. Diese Megastädte wie Bombay sind das Ergebnis eines ökonomischen Modells, das den Bedürfnissen der unterentwickelten Welt überhaupt nicht gerecht wird. Dieses Rohr bringt das Wasser in den reichen Süden von Bombay. Die Leute in den Armenvierteln im Norden gehen auf sauberem Wasser, aber das Wasser, das sie trinken, ist nicht sauber. Sie bohren Löcher, aber das Grundwasser unter den Elendshütten ist durch ihr eigenes Abwasser verdreckt. Das saubere Wasser fließt an ihnen vorbei.
Lässt sich dieses Bild auf Brasilien übertragen?
Unbedingt. Vor 40 Jahren lebten vier Fünftel der Brasilianer auf dem Lande und ein Fünftel in den Städten. Heute ist es genau umgekehrt - wie in Indien. Es ist ein schreckliches Modell. Das Agrobusiness zahlt die Arbeiter auf dem Land schlecht, und durch den Einsatz moderner Technik werden immer weniger gebraucht. Den Menschen bleibt nichts anderes übrig, als in die Stadt zu ziehen.
Die brasilianische Regierung versucht gerade, dieses Modell zu überwinden. Ist das auf nationaler Ebene überhaupt möglich?
Sicher nicht zu hundert Prozent. Präsident Lula übernimmt ein Land, das bereits komplett ins globale System integriert ist. Er muss den Versuch einer internen Umverteilung machen, denn von 175 Millionen Brasilianern sind gerade einmal 25 Millionen Konsumenten. Das ist sehr mühsam. Aber anders geht es nicht, ein revolutionärer Bruch würde heute nicht funktionieren.
Warum sind Sie zum Weltsozialforum gekommen?
Ich möchte mein Projekt nachhaltiger Entwicklung vorstellen, das seit 1991 läuft. Es ist das wohl größte Projekt zur Regenerierung der Umwelt in Brasilien. Wir haben 500.000 Bäume geplanzt, einheimische Sorten aus dem atlantischen Regenwald, und es funktioniert im Zusammenhang mit kleinbäuerlicher Landwirtschaft.
Sie haben in den 70er-Jahren Wirtschaftswissenschaften studiert. Das war die Zeit, als mit den "Chicago Boys" der neoliberale Wirtschaftskurs in Lateinamerika ausprobiert wurde. Wie kommt es, dass Sie trotzdem einen ganz anderen Weg gewählt haben?
Okay, ich hatte tasächlich Vorlesungen bei einem dieser Chicago Boys, aber ich komme auch aus einer ganz besonderen Realtiät, und das ist Brasilien - mit all seinen Widersprüchen und all seiner sozialen Bedürftigkeit. Ich habe angefangen zu fotografieren und habe eigentlich von Anfang an nur soziale Themen fotografiert. Wirtschaftswissenschaften sind ja eigentlich Sozialwissenschaften, und wenn man die Wirtschaft von einer anderen Seite betrachet, landet man beim Sozialen. Meine Fotografie hat mich dazu geführt, die Welt von dieser anderen Seite zu betrachten.
Als Sie mit Ihrer Arbeit anfingen, gab es den Begriff "Globalisierung" da überhaupt schon? Hatten Sie den im Hinterkopf?
Nein, in keinster Weise! Erst als ich an meinem Buch "Arbeiter" arbeitete, begriff ich, dass sich die Welt in eine bestimmte Richtung entwickelt.
In welche?
Die Beziehungen zwischen den Arbeitern und den Produkten, die sie herstellten, und zu dem Kapital, das sie dafür benötigten, sind umgekrempelt worden. In meiner Region im inneren Brasiliens wurde eine riesige Palette von Nahrungsmitteln angebaut: Reis, Bohnen, Milch, Fleisch und so weiter. Die ganze Region hat sich in eine Monokultur verwandelt, heute wird da nur noch Rindfleisch im großen Stil geliefert, Rindfleisch schlechter Qualität. Als ich Fotos in diesen Regionen machte, kapierte ich: Das ist die Globalisierung.
Und dann?
Ich begann mit meinem nächsten Projekt, "Migration". Denn ich sah, Migration ist eine Folge dieser veränderten Arbeitswelt. Migration ist das zweite Kapitel der Globalisierung.
Wird es ein drittes Kapitel geben?
Ja. Das dritte Kapitel soll sich mit der Beziehung des Menschen zu seinem Planeten beschäftigen. Heute sind wir "Stadttiere". Wir haben keine Beziehung mehr zu Erde, Wasser, den Tieren - denken Sie zum Beispiel an BSE. Die sind ein Resultat unserer gestörten Beziehung zur Natur. Wir müssen unsere Beziehung zur Natur erneuern.
Wie reagieren Sie auf die gelegentlich vorgebrachte Kritik, Ihre Bilder seien kitschig?
Man muss jede Person in ihrem Kontext betrachten. Ich bin aus Minas Gerais. Das ist der Bundesstaat von Brasilien, der am meisten "Rokoko" ist, würde ich sagen. Meine Sicht der Welt ist also eine sehr barocke. Ich bin weder Modernist noch Postmodernist in meinem Stil. Mein Stil ist Mainstream, traditionell, meine Art zu Fotografieren ist einfach, normalerweise habe ich einen zentralen Fokus auf meine Bilder. Licht - das begeistert mich. Barockes Licht.
Sie unterscheiden sich also allein durch Ihre Herkunft von einem deutschen Fotografen?
Was glauben Sie - könnte ich wie ein deutscher Fotograf Bilder machen? Wenn ich doch nicht aus einer deutschen Realität komme? Nein. Das wäre ein sehr künstlerischer Stil, sehr exakt, sehr präzise mit vielen direkten Informationen. Ich komme eben aus einer Rokoko-Welt.
Jetzt argumentieren Sie aus der Sicht des Künstlers. Die Kritik kommt aber eher aus einer politischen Ecke: Sie stellen Armut verkitscht da, wo Armut doch grausam ist.
Das konmt eben darauf an, wer die Kritik übt.Wenn ich einen Kritiker aus Paris oder aus Berlin nehme, sagt der vielleicht, die Fotografie muss grausam sein, muss Armut auf eine rohe Art zeigen. Normalerweise haben diese Menschen Armut nie gesehen. Mir kommt es sehr grausam vor, dass die Menschen denken: Was hart ist, muss auch so dargestellt werden.
Die Kritik kommt also nur aus Europa?
Hier in Brasilien wurden meine Fotos nicht als Kitsch betrachtet, in Indien auch nicht.
Sind Sie als Fotograf Teil der Bewegung, oder sollten Sie eine gewisse Distanz bewahren?
Ich habe nie eine Distanz gewahrt. Ich habe so viel über die Bewegung der Landlosen in Brasilien gemacht, ich gehöre zu dieser Bewegung dazu. Ich lebe in einem interaktiven Universum zwischen dem Fotografen und seinen Motiven.
In Porto Alegre wird viel über den drohenden Irakkrieg gesprochen. Im Jugoslawienkrieg haben die Medien grausame Bilder gezeigt und sind zum Teil heftig dafür kritisiert worden.
Diese Bilder waren in diesem Fall nötig, weil unsere Gesellschaft sie braucht, um sich zu informieren, um zu provozieren, die ganze Debatte in der Gesellschaft über den Krieg - das war nötig, auch um Spenden für die Kriegsopfer lockerzumachen, um eine Antikriegsbewegung zu schaffen.
Was bedeutet für Sie das Weltsozialforum?
Für mich ist das ein Beispiel für Demokratie, für Partizipation, für Diskussion. Wir müssen es schaffen, solche Foren überall auf der Welt durchzuführen. Ich habe 1973/74 in Portugal gearbeitet, als das Land gerade aus der Diktatur kam. Portugal hat zwei Jahre lang nicht gearbeitet - Portugal hat diskutiert! Ich habe beim Metzger zwei Stunden gebraucht, um mein Fleisch zu kaufen, weil die Menschen in der Schlange und die Verkäufer die ganz Zeit nur diskutieren wollten! Wir befinden uns in einer ähnlichen Situation mit der Globalisierung. Wir müssen diskutieren!
TAZ, 28.1.2003
Salam alaikum in Porto Alegre
von KATHARINA KOUFEN
Es wuselt. Alle wuseln irgendwohin, Treppe rauf, Treppe runter, Aufzug rein, Aufzug raus. Nur einer sitzt auf den Stufen in Gebäude drei. Stützt das Kinn auf die geballte Faust, kratzt sich mit der anderen Hand die grau melierten kurzen Locken und zieht missmutig die Augenbrauen zusammen, so dass sich die Furche über seiner Nase vertieft. "Der Workshop, zu dem ich hinwollte, ist ausgefallen", sagt Mamdouh Habashi. "Dabei bin ich ungefähr zwei Stunden durch sämtliche Gebäude dieser Uni gelaufen, bis ich den richtigen Raum gefunden habe."
So, wie man sich den typischen Globalisierungskritiker vorstellt, also jung, links, studierend und mit wenig Geld in der Tasche, sieht Habashi überhaupt nicht aus. Er ist 51 Jahre alt, Bauunternehmer, trägt eine schicke Uhr mit dem Schriftzug der eigenen Firma und einen Ehering. Und: Seine Muttersprache ist weder Englisch, noch Spanisch, Brasilianisch, Französisch oder Deutsch, wie es bei dem ganz großen Teil der Teilnehmer am Weltsozialforum im brasilianischen Porto Alegre der Fall ist. Seine Muttersprache ist Arabisch.
Wenn ein Ägypter wie Mamdouh Habashi nun extra nach Brasilien kommt, dann möchte er mit dem Gefühl nach Hause fliegen: Das hat sich gelohnt. "Dieses Gefühl werde ich dann haben, wenn ich sagen kann: Ich habe neue Kontakte geknüpft und ich habe meine Organisation vorgestellt." Dafür braucht Habashi mindestens ein verlässliches Programm.
Weil es das offensichtlich nicht gibt, beschließt der Ägypter, sein "Networking" auf eigene Faust zu betreiben. Er erhebt sich von der Treppe und macht sich auf der Suche nach anderen Arabern. In Gebäude 50 soll eine Diskussion mit Nawal El Saadawi stattfinden, Ägyptens berühmtester Schriftstellerin. Und im Stadion "Gigantinho" spricht gleichzeitig Sherif Hetata über Fundamentalismus. Er ist Nawal El Saadawis Mann.
Beide kennen Habashi, und die ägyptische Zuhörerin in der ersten Reihe kennt alle drei, aber das ist nichts Besonderes, wie sich im Laufe des Tages herausstellt: Alle anwesenden Ägypter kennen sich, sind befreundet oder verwandt. Was nicht weiter erstaunt: Ägyptens Globalisierungskritiker sind ein überschaubarer Haufen.
Das will Habashi ändern. Er trommelt sämtliche Ägypter zusammen, mehr als ein Dutzend sind es nicht. Wenn er seine Landsleute auf Arabisch anspricht, kommt es vor, dass sich ein Brasilianer oder eine Uruguayerin nach ihm umdreht und fragt: Wo kommst du her? Und auf die Antwort "aus Ägypten" mit einem überraschten "Wow!" antwortet. Am Nachmittag wollen sich die arabischen Delegierten treffen, "kommt alle dahin", bittet Habashi. Die 71-jährige Schriftstellerin Nawal El Saadawi zieht er am Arm hinter sich her, weil sie nach ihrem Vortrag immer wieder um ein Foto gebeten wird oder ein Buch signieren soll und stehen bleibt.
Dann endlich darf Habashi reden. Erzählen, was er meint, wenn er "meine Organisation" sagt. Ageg heißt sie und ist Ägyptens erstes globalisierungskritisches Netzwerk. Ageg steht für Anti Globalization Egyptian Group. "Ageg" heißt auf Arabisch aber auch "Feuerknistern". Habashi grinst. "Es beginnt jetzt auch in Ägypten zu knistern. Wir wehren uns gegen die neoliberale Globalisierung." Er sagt es auf Englisch, eine Dolmetscherin übersetzt ins Spanische, für eine Gruppe Argentinier, die in einer Ecke Platz genommen haben.
Außer den Argentiniern sitzen im Seminarraum etwa 20 Männer und zehn Frauen auf weißen Plastikstühlen. Die meisten sind Palästinenser, und wer nicht Palästinenser ist, hat sich zumindest ein schwarz-weißes Palästinensertuch über das Sommerhemd oder Poloshirt geworfen. Einige tragen einen schwarz-weißen Schal mit roten und grünen Fransen - den Farben Palästinas. Aber ausnahmsweise dominiert nicht der Nahostkonflikt die Diskussion, es geht um die "Zukunft der sozialen Bewegung in den arabischen Ländern", wie es ein Zettel an der Tür ankündigt.
Das Wort Bewegung ist, das wird aus den Berichten der Syrier, Libanesen, Marokkaner, Palästinenser und Ägypter klar, im Zusammenhang mit den arabischen Ländern eine Beschönigung. "Von Bewegung kann man bei uns gar nicht sprechen. Über Globalisierungskritik denken nur ein paar Intellektuelle nach", berichtet Habashi. Warum das so ist, will eine französische Journalistin wissen. "Bei uns sind Nichtregierungsorganisationen reine Wohltätigkeitsvereine, mehr nicht", meint Nihad Gohar, eine Studentin aus Kairo. Habashi nennt einen anderen Grund: "Unsere Gesellschaften sind nicht frei."
Für die arabischen Teilnehmer hat Porto Alegre deshalb noch eine andere Bedeutung: "Ein Gefühl von Freiheit." Habashis Mitstreiter Alaa Shoukrallah, ein Frauenarzt aus Kairo, sagt: "In Ägypten bist du schon verdächtig, wenn du dich mit ein paar Leuten zum freien Gedankenaustausch triffst." Er rechnet fest damit, dass er und die anderen Ägypter bei der Rückkehr Probleme bekommen. Keine Einreise ohne Durchsuchung, "meistens dauert es mindestens eine Stunde, bis die mein Gepäck gecheckt haben". Keine Passkontrolle, ohne dass der Computer des Beamten rot leuchtet: "Wir stehen auf der Wanted-Liste der Regierung." Das heißt: Nicht nur jede Reise wird registriert, sondern auch jedes Telefongespräch, jede Versammlung.
"Im Moment werden wir geduldet", meint Habashi. "Aber die Regierung kann uns jederzeit ins Gefängnis stecken." Habashi weiß, was das bedeutet. Seine Eltern saßen mehrmals im Gefängnis, weil sie Kommunisten waren.
Seit einem halben Jahr gibt es in Ägypten ein Gesetz, dass Nichtregierungsorganisationen sich beim Sozialministerium anmelden müssen. Ageg hat das bisher nicht getan. "Uns gibt es ja erst seit ein paar Monaten, wir haben jetzt erst im Februar unsere erste Versammlung mit allen Mitgliedern." Immerhin "einige hundert" seien es. Habashi hat seine Organisation absichtlich nicht Attac genannt, um die "Stasi", wie er die Regierungsspitzel nennt, nicht misstrauisch zu machen. "Attac kennt man schon zu sehr."
Die Regierung, sagt Habashi, passt auch darauf auf, dass die Globalisierungskritik nicht aus dem kleinen intellektuellen Kreis in Kairo heraus- und in die Köpfe der breiten Bevölkerung hineindringt. "Sie will immer alles steuern, kontrollieren." Mit Schaudern erinnern sich Habashi und Alaa Shoukrallah an die Studentenbewegung Anfang der 70er-Jahre. Habashi hatte in Kairo demonstriert und kam, wie viele andere, für kurze Zeit ins Gefängnis.
Ageg möchte genau das erreichen, was die Regierung Mubarak auf jeden Fall verhindern will. "Der kleine Bauer auf dem Land soll kapieren, was die Globalisierung damit zu tun hat, dass er keinen Weizen mehr anbaut, sondern für wenig Geld Tomaten erntet, die anschließend nach Europa exportiert werden. Oder dass es eine Auflage des Internationalen Währungsfonds ist, wenn die Regierung ein neues, total arbeitgeberfreundliches Arbeitsgesetz einführt."
Ein bisschen neidisch schaut Habashi auf das Gewusel auf den Wegen und Rasenflächen zwischen den Unigebäuden. Die Palästinenserdemo ist ausgefallen, warum weiß er nicht genau. Die Brasilianer führen hier vor, wie bunt Zivilgesellschaft aussehen kann. Anhänger der Arbeiterpartei verkaufen Sticker und T-Shirts, ein paar konvertierte brasilianische Islamistikstudenten grüßen die Vorbeigehenden mit "Salam alaikum". "Ich fühle mich wohl hier, das ist wie Hoffnung tanken", sagt Habashi. "Aber manchmal schaudert mich auch, wenn ich daran denke, welche Kluft zwischen Wunschdenken und Wirklichkeit liegt."
TAZ, 29.1.2003
Eine neue Welt, bitte!
Mit einem Aufruf zum Kampf für eine gerechtere Weltordnung endete das 3. Weltsozialforum in Porto Alegre. 30.000 Menschen demonstrieren bei der Schlussveranstaltung gegen den Irakkrieg
Mit einer Großdemonstration gegen die Kriegsvorbereitungen der USA am Persischen Golf ist am Montagabend das dritte Weltsozialforum zu Ende gegangen. Zudem protestierten die rund 30.000 Menschen auf der Abschlusskundgebung mit Trommeln und Sprechchören gegen die von Washington propagierte gesamtamerikanische Freihandelszone (FTAA).
In einem "Aufruf der sozialen Bewegungen", den mehrere hundert Organisationen mittragen, werden "Krieg und Militarismus" verurteilt. Für den 15. Februar ist ein weltweiter Antikriegstag geplant.
Vertreter deutscher Gruppen lobten die zahlreichen Treffen und Diskussionsmöglichkeiten. Es seien Kontakte zu Initiativen mit gleichen Zielen aus anderen Ländern geknüpft und gemeinsame Strategien ausgearbeitet worden, sagte Marc Engelhardt vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND).
Oliver Moldenhauer von Attac Deutschland nannte drei Schwerpunktthemen: den Widerstand gegen die amerikanische Freihandelszone, die Bekämpfung der Steuerflucht sowie den Aufbau eines Informationsportals im Internet.
Zu dem bisher größten Treffen der globalisierungskritischen Bewegungen aus aller Welt waren 100.000 Teilnehmer ins brasilianische Porto Alegre gereist. 20.763 offizielle Delegierte aus 5.171 Organisationen und 156 Ländern nahmen an rund 1.500 Veranstaltungen teil. Akkreditiert waren über 4.000 Journalisten aus 56 Ländern. Nach einem Beschluss des Internationalen Rates des Weltsozialforums wird das Großtreffen im kommenden Jahr in Indien organisiert.
Zu den nächsten großen Treffen, zu denen die Globalisierungskritiker mobilisieren, gehören der G-8-Gipfel, der Anfang Juni im französischen Evian stattfinden soll, sowie das Treffen der Welthandelsorganisation WTO im September im mexikanischen Cancun.
TAZ, 29.1.2003
WELTSOZIALFORUM IN PORTO ALEGRE
Das Weltsozialforum in Brasilien ist zu Ende. Die Abschlusserklärung "Brief von Porto Alegre" ist ein schnörkelloser Appell gegen einen drohenden Irakkrieg und für Frieden und globale Gerechtigkeit. Die 100.000 Teilnehmer nehmen vor allem Inspirationen für ihre politische Arbeit mit nach Hause
der journalist: "Wichtige Kontakte knüpfen"
taz: Warum sind Sie schon zum dritten Mal nach Porto Alegre gekommen?
Carlos Gutierrez: Für mich sind die informellen Kontakte zu anderen Lateinamerikanern wichtig. Aus unseren Medien erfährt man recht wenig über unsere Nachbarländer. Außerdem habe ich im Oktober das kolumbianische Sozialforum mitorganisiert und bin Chefredakteur der kolumbianischen Le Monde diplomatique - schon deshalb musste ich einfach kommen.
Hat sich das Sozialforum verändert?
Schwer zu sagen. Ich glaube, die konkreten Fortschritte finden in den Workshops statt, aber wie will man das messen? Ich wünsche mir mehr kontroverse Debatten. Gerade bei der Besetzung der Podien ist vieles eingefahren. Und es ist noch nicht abzusehen, ob und wie schnell sich daran etwas ändert, denn an der Spitze laufen die Diskussionen eher zäh.
Was war Ihr persönliches Highlight?
Die Stippvisite von Hugo Chávez.
(Carlos Guitérrez, 40, Journalist aus Bogotá/Kolumbien)
die sozialarbeiterin: "Die Machtfrage stellen"
taz: Wie waren Ihre ersten Eindrücke vom Sozialforum?
Angela Jones: Ich hatte zuerst enorme Sprachprobleme. Die Verständigung mit den Brasilianern war schon schwierig, und von vielen Themen hatte ich keine Ahnung, denn über andere Länder steht ja so gut wie nichts in unseren Zeitungen.
Was hat Sie am meisten beeindruckt?
Wie die Brailianer Lula verehren und respektieren - so etwas ist bei uns unvorstellbar. Allerdings haben wir auch verstanden, dass die Arbeit für die hiesigen Aktivisten damit noch nicht zu Ende ist. Sie fühlen sich dafür mitverantwortlich, dass er das, wofür er gewählt wurde, auch wirklich umsetzt - das war eine Lektion für mich.
Welche Anregungen nehmen Sie mit?
Es wird mir nicht mehr reichen, nur Gemeinschaftsarbeit in meinem Viertel zu machen. Mit meinen Freunden will ich mich an dem Netzwerk "Nachhaltiges Detroit" beteiligen. Und ich habe gemerkt, wie wichtig die Frage politischer Macht ist - auf allen Ebenen.
(Angela Jones, 22, macht Stadtteilarbeit in Detroit/USA)
der aktivist: "Die Energie spüren"
taz: Was hat Ihnen das Forum gebracht?
Pak Jun Kyo: Ich habe viele Leute getroffen, die konkrete Schritte gegen den Irakkrieg unternehmen wollen. Dieser persönliche Kontakt ist Gold wert. An dem Friedensworkshop, den unsere Gruppe "All Together" organisiert hat, haben Leute aus Japan, Frankreich, Kanada und den USA teilgenommen.
Wie sind Sie mit der brasilianischen Kultur zurechtgekommen?
Es war schon seltsam, aus dem tiefsten koreanischen Winter in den Hochsommer zu kommen. Das verursacht mir immer noch mehr Kopfschmerzen als Vergnügen. Und von Brasilien kannte ich ja nur die Fußballspieler. Auf einem Treffen mit den Landlosen habe ich die Energie gefühlt, die von dieser Bewegung ausgeht.
Und was hätten Sie anders organisiert?
Dass ich das Programm mit den Workshops erst am dritten Tag bekommen habe, hat mich geärgert. Da bin ich nicht der Einzige.
(Pak Jun Kyo, 34, ist Friedensaktivist aus Seoul/Südkorea)
TAZ, 29.1.2003
Protest und Polemik
Zum Schluss schlägt in Porto Alegre die Stunde der Promis: Venezuelas Präsident Chávez verspricht die Tobin-Steuer
aus Porto Alegre GERHARD DILGER
Eines lässt sich mit Gewissheit sagen: Noch nie in seiner dreijährigen Geschichte war das Weltsozialforum so stark von einem Thema und einer Person geprägt: George W. Bush und der drohende Irakkrieg spielten in den meisten Foren und auf allen Kundgebungen die dominierende Rolle. Und der brasilianische Präsident Lula war eigentlich dauernd präsent - sei es persönlich, sei es via Videoleinwand aus Davos oder auf unzähligen Stickern, Mützen, T-Shirts, Taschenkalendern oder Feuerzeugen.
Zum Thema Irakkrieg erarbeiteten israelische und palästinensische Friedensaktivisten gemeinsam einen "Brief von Porto Alegre" - einen schnörkellosen Appell für ein "Ende der Gewalt auf beiden Seiten" und für Verhandlungen, für den Rückzug Israels aus den besetzten Gebieten und die Gründung eines Palästinenserstaates. Als die Israelin Galia Golan den Brief zum Abschluss des Forums vor 20.000 Zuhörern verlas, fassten sich die Menschen bei den Händen. Die jüngsten Attacken der israelischen Armee auf Gaza hatten der aufgeheizten Anti-Israel-Stimmung in Porto Alegre zusätzliche Nahrung gegeben, das Dokument kam deswegen erst in letzter Minute zustande.
Für den Bostoner Linguisten Noam Chomsky, einen der Stars des Forums, ist der Krieg mehr als eine Bedrohung für den Irak und die arabischen Staaten. Vielmehr seien die USA unter Präsident George W. Bush zu einer "Bedrohung für sich und die gesamte Menschheit geworden", so Chomsky. Hinter der "Konstruktion eines Feindes, der angeblich zu einem Völkermord bereit" sei, verberge sich der "amerikanische imperialistische Ehrgeiz, sich mit Gewalt durchzusetzen." Trotz dieser im September angezettelten Angstkampagne sei die Friedensbewegung in den USA auf ein bisher "ungekanntes Niveau angewachsen." Chomsky sagte in einer überfüllten Sporthalle in Porto Alegre: "Ein Krieg gegen den Irak wird eine neue Generation von Terroristen hervorbringen und den Rüstungswettlauf beschleunigen." Nach seiner Analyse übergab er das Wort an die indische Schrifstellerin Arundhati Roy, die das Publikum mit purer Polemik in Rage versetzte.
Absoluter Höhepunkt des Weltsozialforums war der Lula-Besuch in Porto Alegre, zu dem rund 80.000 Menschen kamen. Weitere zigtausend blieben im "Lula-Stau" stecken und mussten sich den Auftritt ihres Präsidenten abends im Fernsehen anschauen.
Lulas anschließende Fahrt zum Weltwirtschaftsforum führte zu heftigen Debatten - schließlich definiert sich das Weltsozialforum bewusst als Gegenpol zu Davos, wo sich die "Herren des Universums" versammeln, wie Chomsky es ausdrückt. Für die Menschen in Porto Alegre ist klar, dass Davos an Bedeutung verliert - eine Einschätzung, die mittlerweile auch viele internationale Medien teilen. "Während Porto Alegre von Jahr zu Jahr größer wird und immer mehr Optimismus und Energie versprüht, versinkt Davos in Verzweiflung", sagte Chomsky.
Im Nachhinein dürfte allerdings auch den Gegnern von Lulas Besuch in Davos klar werden: Mit diesem Schritt erhielt das Forum eine internationale Aufmerksamkeit wie nie zuvor. In Porto Alegre spricht man in diesem Zusammenhang nur noch vom "Faktor Lula".
Auf Rang zwei der Promi-Liste kam der venezolanische Präsident Hugo Chávez. Der umstrittene Staatsmann war kurzfristig nach Porto Alegre geflogen, um sich von seinen Fans die Seele streicheln zu lassen. Zu Hause hat er es zurzeit schwer. In seinem Land halten die Massenproteste und Streiks nun bereits neun Wochen an. In Porto Alegre erklärten sich viele lateinamerikanische Organisationen solidarisch mit "Cha-Cha-Chávez". Sie interpretieren den Streik im Sinne des Präsidenten: als Verschwörung der Opposition mit Unterstützung des ausländischen Kapitals gegen ihn.
Um wie Lula ein bisschen internationale Aufmerksamkeit zu erzielen und wohl auch, um mit der Bewegung anzubandeln, überraschte Chávez in Porto Alegre mit einer erfreulichen Nachricht: Sein Land will die Tobin-Steuer einführen. Diese Steuer auf Währungsgeschäfte gehört zu den elementaren Forderungen des Weltsozialforums.
Chávez griff sich in Porto Alegre denn auch gleich die Tobin-Experten: Bruno Jetin von Attac Frankreich und ein weiterer Fachmann wurden kurzerhand zu seinen Regierungsberatern ernannt und flogen noch am Sonntag auf Einladung des Präsidenten nach Caracas. Bernard Cassen, Gründungsmitglied von Attac Frankreich, bestätigte dies gestern. Über Einzelheiten ist allerdings nichts bekannt. Chávez hatte nur gesagt: "Ich will Devisenkontrollen einführen, so eine Art Tobin-Steuer."
Hintergrund für den unerwarteten Schritt: Venezuelas Dollarreserven sind in den letzten zwei Monaten um drei Milliarden gesunken. Seit Beginn des Streiks hat die heimische Währung 30 Prozent ihres Wertes gegenüber dem Dollar verloren. In Porto Alegre wurde die Nachricht von Chávez Plan mit einer Mischung aus Freude und Zweifel aufgenommen - Zweifel darüber, ob sich die Tobin-Steuer im Alleingang durchführen lässt, aber auch über die Zukunft des Präsidenten, der auf einem wackeligen Thron sitzt.
Trotz einiger Schwierigkeiten der Organisatoren, die 100.000 Teilnehmer des Forums in den jeweils richtigen der 1.300 Workshops zu schicken, fällt das Fazit der meisten Globalisierungskritiker positiv aus. "Für mich war es eine exzellente Gelegenheit, mich mit anderen Weltbankkritikern kurzzuschließen", resümiert etwa Johan Frijns von "Friends of the Earth International". Jens Marten, der für den deutschen Entwicklungsverband Weed nach Porto Alegre gekommen ist, berichtet, er habe sich mit Menschen aus Ländern getroffen, wo Globalisierungskritiker umgebracht werden, wenn sie zum Beispiel gegen Privatisierung sind. "Wir dagegen sitzen zu Hause doch relativ komfortabel am Schreibtisch. Mein Fazit: Wir sollten konfrontativer werden!" Und für den Marburger Soziologen Dieter Boris ist Porto Alegre "einfach nur eine Riesentankstelle für politische Energie".
TAZ, 29.1.2003
PORTO ALEGRE HAT SICH ETABLIERT - UND WIRD IMMER MEHR WIE DAVOS
Die Wir-Seligkeit reicht nicht mehr
von KATHARINA KOUFEN
Vom bloßen Anti-Gipfel 2001 hat sich Porto Alegre in diesem Jahr zu einem Ereignis entwickelt, das weltweit ernst genommen wird. Das zeigt, dass die Globalisierungskritik in die Mainstream-Diskussionen vordringt. Gleichzeitig hat diese Etablierung aber auch eine Schattenseite. Porto Alegre wird offiziellen Gipfeln wie Davos immer ähnlicher, und das bringt einige Probleme mit sich.
Längst geht es nicht mehr nur um die bloße Ablehnung einer neoliberalen Globalisierung. Auch reicht es vielen Teilnehmern nicht mehr, in einem Gefühl der Wir-Seligkeit für die gute Sache zu demonstrieren. Vielmehr erwarten sie heute einen praktischen Nutzen von dem gigantischen Treffen. Ganz wie in Davos spricht man in Porto Alegre heute von "Networking".
Darum muss das Forum sich davor hüten, zum bloßen Ritual zu degenerieren. Die großen Themen der Globalisierung sind in diesem Jahr nicht viel anders als im letzten. Jedes Jahr zusammenzukommen und die gleichen Forderungen aufzustellen wie im Vorjahr - das macht schon Davos. Von dort kennt man auch den Starkult, der um die Helden der Ökonomie betrieben wird. In Porto Alegre werden die Helden der Gegenbewegung vergöttert. Geht die Entwicklung so weiter, werden Noam Chomsky und Susan George demnächst Kinderköpfe streicheln und Bäumchen pflanzen. Schließlich müssen sich die Teilnehmer von Porto Alegre immer wieder vor Augen halten, dass sie einen globalen Anspruch haben. In Davos dominiert das Wirtschaftsmodell der Industrienationen; aus dem reichen Norden kommen deutlich mehr Gäste als aus dem armen Süden. In Porto Alegre besteht die Grenze eher zwischen West und Ost: Die allermeisten Teilnehmer sind Latinos, der Rest fast ausschließlich Europäer. Auch wenn man das in Porto Alegre nicht gerne hört: Der christlich-abendländisch geprägte Kulturkreis dominiert. Aus Asien und Afrika kommen nur ein paar wenige Prominente wie Martin Khor oder Walden Bello. Gut, dass das nächste Weltsozialforum in Indien stattfinden soll: Es wird die Begeisterung für den linken Präsidenten Lula und die Ablehnung der gesamtamerikanischen Freihandelszone in den Hintergrund drängen und Platz für die Probleme der asiatischen Region machen.
Mit dem Wegzug aus Porto Alegre dürfte allerdings auch die lockere Partystimmung vorbei sein. Unten Minirock, oben Bikini-Oberteil - das passt nicht nach Indien. Und je nachdem, für welchen Teil des Landes sich die Veranstalter entschließen, könnten im nächsten Jahr erstmals Sicherheitsvorkehrungen notwendig werden. Dann hätte das Weltsozialforum noch eine weitere Gemeinsamkeit mit Davos.