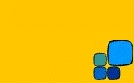Berichte
Der Code der Armut
(von BERND GRAFF, Süddeutsche Zeitung)
Es sind drastische Worte: „Schon jetzt“, erklärte John Barlow auf dem Weltsozialforum im brasilianischen Porto Alegre, „gibt Brasilien mehr Geld für Software aus als für den Kampf gegen den Hunger.“
Barlow ist Mitbegründer der „Electronic Frontier Foundation“, einer 1990 entstandenen amerikanischen Organisation, deren Name nach Wildem Westen und weitem Land klingt.
So hat sie es sich zum Ziel gesetzt, „eine Zivilisation im elektronischen Grenzbereichs fördern, um diesen nicht nur für eine technische Elite, sondern für jedermann zugänglich und nützlich zu machen.“
Dies „unter Berücksichtigung der besten Traditionen unserer Gesellschaft im Hinblick auf freie Information und Kommunikation.“ Und mit solchem Auftrag ist man im Wilden Westen.
Denn „im elektronischen Grenzbereich“ finden weltweit Scharmützel statt.
Längst ist Software ein Politikum, nicht nur im fernen Porto Alegre, auf dem Weltsozialforum, wo Barlows drastische Worte der Globalisierungskritik Nachdruck verleihen sollen. So viel ist klar: Seine Bemerkungen berühren ein Problem, das viel älter und auch komplexer ist, als es die ebenso schneidige wie schiefe Gleichung zwischen Hunger und Software beschreibt.
Tatsächlich sollen Polarisierungen wie jene Barlows wohl in Erinnerung rufen, dass der schreiende Gegensatz zwischen Erster und Dritter Welt schon einmal nach flammenden Appellen überbrückt werden konnte.
So stritt man etwa jahrelang um die Preise für Medikamente und die Kosten der Behandlung, die Aids-Infizierte in Entwicklungsländern zu zahlen haben. Unter anderem hatte sich schließlich der ehemalige amerikanische Präsident Bill Clinton erfolgreich dafür eingesetzt, dass mit den verbilligten Präparaten „bald viele hunderttausende oder sogar Millionen Menschen länger leben können“.
Doch auch wenn Barlows Aussage es suggeriert, geht es nicht ums nackte Überleben. Tatsächlich geht es um die Verfügbarkeit von Software überhaupt und um die Patentierbarkeit von Programm-Code. Es geht um handfeste ökonomische Interessen, um Lizenzen, Monopole und Tantiemen, die je nach Perspektive als „Reglementierungen“ verstanden, wie es die Software-Industrie sieht, oder als „Restriktionen“, wie es die Aktivisten nennen.
Denn „die armen Länder“, so Barlow in seinem Statement weiter, „können ihre Probleme nur dann lösen, wenn sie ihre Ausgaben für kommerzielle Software-Lizenzen einstellen“ – und auf freie Software setzen.
Und da ist er wieder, der Software-Graben, der „digital divide“ zwischen Arm und Reich.
Wollen die Politiker der Ersten und Dritten Welt verantwortlich sein dafür, dass sie einem Software-Aids-Debakel in katastrophalem Ausmaß tatenlos zugesehen haben?, so lautet sinngemäß Barlows polemische Analogie.
Aber ist Software überhaupt zukunftsentscheidend? Sie ist es.
Man muss sich nur vor Augen halten, dass innerhalb der Infrastrukturen von Staaten, Organisationen und Konzernen kaum noch eine Technologie existiert, die nicht softwarebasiert ist, die also nicht auch Informations-Technologie ist.
Vom Handy bis zur Aufzugsteuerung, von der Pkw-Produktion bis zur Pharmazeutik und Verkehrstechnik gibt es fast nichts, das nicht auch auf einen Programmier-Code angewiesen ist.
Wenn Teile der Welt vom Zugang zu Steuerungs- und Betriebs-Software abgeschnitten bleiben, indem man etwa überteuerte Produkte mit dem Zwang zu teueren Updates anbietet, dann verhindert man, dass Länder jemals die Schwelle zum Wohlstand oder auch nur zur Autarkie überschreiten. Medizin ist dabei nur einer dieser Bereiche. Ökonomie heute ist im weitesten Sinne Informations-Verarbeitung. Darum riskiert man ohne sie sogar den Verlust von Kommunikation überhaupt: Drittweltländer, die Standards in den IT-Bereichen nicht halten können, sind bald nicht mehr anschlussfähig und folglich isoliert. Das aber verhindert den dortigen Aufbau und Fortschritt und stärkt Diktaturen.
Besteht in diesem Punkt noch weitgehend Einigkeit, reiben sich die Interessen sogleich an der Frage, wie und vor allem womit die notwendige Anschlussfähigkeit hergestellt und erhalten werden soll. Natürlich haben Großkonzerne wie Microsoft – Bill Gates sprach gerade bezeichnender Weise in Davos beim Weltwirtschaftsgipfel – ein Interesse daran, neue Märkte auch in den Schwellenländern zu erschließen.
Die publikumswirksame Kritik, man könne daran ja erkennen, dass bestimmte Konzerne „sich die Welt nach ihrem Business-Modell“ untertan machen – eine Kritik, die Sergio Amadeu vom „Institut für Nationale Brasilianische Informations-Technologie“ in Porto Alegre äußerte –, greift tatsächlich zu kurz.
Viel wichtiger ist es, danach zu fragen, in welche Handlungsposition sich Nationen bringen, die Fremd-Technologien lediglich importieren, ohne sie jemals selber auf ihre Bedürfnisse zuschneiden zu können.
Hermetisch verschlossene Produkte, die vom Produzenten lediglich as is an den Abnehmer gebracht werden, verschärfen genau die Abhängigkeiten, von denen die Länder sich befreien wollen.
Ein Problem, das jedem Entwicklungshelfer geläufig sein dürfte.
Andererseits fragt der Autor Michael Kofler zu Recht: „Was ist gewonnen, wenn man Drittweltstaaten nur auf die Verfügbarkeit freier Software hinweist? Es muss doch bereits genügend Know How dort sein, um damit auch bedürfnisgerecht arbeiten zu können.“
Ein Problem, das jeder Linux-Neuling kennt.
Kofler, der sich mit Büchern zu dem freien Betriebssystem Linux hervor getan hat, von denen einige inzwischen als Standardwerke gelten, bleibt bei der Barlowschen Forderung skeptisch: „Man kann und darf von freier Software allein keine Wunder erwarten.“
In Europa, also diesseits des „information gap“, tobt gerade ein anderer Kampf vor dem EU-Parlament. Unter dem Stichwort „Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen“ wird hier das Problem verhandelt, ob auch in Europa künftig Patentschutz für Software angemeldet werden kann und welche Folgen das haben wird. Die Crux daran: Sollten die Patente eingeführt werden, wird man auch die bis dahin freien Codes auf ihre Grundlagen und Bestandteile untersuchen.
Dann aber droht eine Flut von Klagen – und zwar gegen Autoren von genau jener freien Software, die gerade als Lösung für die Dritte Welt angeboten wird.