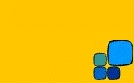Berichte
Hugo Total
(von Wolf-Dieter Vogel, Jungle World)
Rund 80000 Menschen nahmen in der vergangenen Woche am lateinamerikanischen Teil des 6. Weltsozialforums (WSF) in der venezolanischen Hauptstadt Caracas teil. Verteilt auf zehn Orte fanden etwa 2000 Veranstaltungen, Workshops und Seminare statt. Die Themen waren so vielfältig wie die globalisierungskritische Bewegung Lateinamerikas. Vertreter von Bauernorganisationen diskutierten über die Notwendigkeit einer Landreform, Indígenas über Ausgrenzung und indigene Rechte, Radiofreaks über das Recht auf freie Kommunikation, HipHopper über schwarze Befreiung in den USA, Schwule und Lesben über »Homophobie, Transphobie und Biphobie«, Gewerkschafter über die Arbeitsbedingungen in Weltmarktfabriken, Migranten über die geplante neue Mauer zwischen den USA und Mexiko. Alle zusammen sprachen sich »gegen Imperialismus und Krieg« aus und brachten ihre Ablehnung des Irak-Kriegs auf einer Auftaktdemonstration am 24. Januar zum Ausdruck.
Warmlaufen
Die Avenida Bolívar hat für jeden etwas zu bieten: Chávez – der Militär, Chávez – der Staatsmann, Chávez – der hemdsärmelige Kumpel, und das wahlweise in Rot, Schwarz oder Grün. Oder soll es lieber eine Chávez-Puppe sein? Oder die bolivarische Verfassung im Streichholzschachtelformat? Zwischen etwas heruntergekommenen Hochhäusern Marke Ölboom der siebziger Jahre und neu angelegtem Ökogarten beginnt der Supermarkt der bolivarianischen Revolution. Über einen Kilometer hinweg zeigt die venezolanische Regierung, was sie zu bieten hat. Aber nicht wegen des Weltsozialforums, wie später die forumseigene Zeitung Terraviva erklärt. Zufällig ist gleichzeitig der 48. Jahrestag des Endes der Militärdiktatur.
Gekleidet in rote T-Shirts und mit roten Mützen stehen junge Männer und Frauen hinter großräumigen Infoständen. Sie preisen die Erfolge der Regierung an. Etwa das Projekt Barrio Adentro, das kubanische Ärzte in die Armenviertel holt. Oder die Mission Habitat. »Die Revolution beginnt mit dem eigenen Dach über dem Kopf«, heißt es am Infostand. Die »Bolivarianische Front des Außenministeriums« wirbt mit einem Plakat, das einen nachdenklichen Chávez zeigt. »Ein Revolutionär darf sich nicht in Ausreden flüchten, wenn er seine Aufgaben nicht erfüllt. Er muss ein wahrer Soldat sein«, zitiert das Poster den Staatschef. Am Tag zuvor haben hier, im Herzen von Caracas, etwa 10000 Antichavistas gegen Regierungschef Hugo Chávez demonstriert.
Senden und Empfangen
Radio Alba überträgt aus einem grauen Häuschen im Parque Los Caobos. Auf dem Stückchen Grün im Zentrum von Caracas haben sich alle möglichen Leute niedergelassen: Freaks, Anarchos, Jongleure. Es riecht nach Lagerfeuer, mehrere hundert Zelte stehen zwischen den Bäumen, auf den Wegen steht alle 50 Meter ein Lautsprecher. Das scheint aber etwas übertrieben, denn von den erwarteten 30000 Teilnehmern des Jugendcamps »Weltstadt« ist nach Schätzungen der Logistikbeauftragen Maria Esther Cabrera nur ein Zehntel gekommen.
Radio Alba lässt sich davon nicht beeindrucken. Der Moderator interviewt einen kolumbianischen Indígena, der über die Mühen der Anreise nach Venezuela berichtet. Und über den »sozialen Krieg« in seiner Heimat. Dann ein kleiner inhaltlicher Bruch: »Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass um 18 Uhr auf der Bühne im Park ein HipHop-Konzert beginnt.«
Die Radiomacher aus dem Parque Los Caobos sind bei einem der kleinsten Medienprojekte tätig, die im Rahmen des Weltsozialforums auf Sendung gehen. Netzwerke freier Radios aus ganz Lateinamerika haben sich im Arauca-Hotel eingerichtet, um über das Geschehen zu berichten.
Wieder einmal trumpft Venezuela auf: »150 Community-Radios sind mit Hilfe der bolivarianischen Regierung hier entstanden«, berichtet ein Angehöriger der venezolanischen Regierung. Für Dauerinformation über das globalisierungskritische Happening sorgen gleich zwei Fernsehsender: das mit Unterstützung von Chávez gegründete Projekt Telesur und die staatliche Station TeVe senden Werbetrailer, Interviews und Live-Mitschnitte. »Um wirklich alternativ zu sein, müssen wir massenhaft wahrgenommen werden. Wir müssen die Leute erreichen«, erklärt Telesur-Chef Aram Ahronian.
Kämpfe
»Viva Mexiko, viva Venezuela!« ruft Companero Felipe, wie ihn die anderen auf dem Podium nennen. Die rund 100 Teilnehmer der Veranstaltung sind begeistert. Der Companero aus dem mexikanischen Bundesstaat Guerrero hat über den Kampf seiner und anderer Gemeinden gegen einen geplanten Staudamm gesprochen. »Mit allen Kräften werden wir uns gegen jene wehren, die uns unser Land wegnehmen wollen«, sagt er. Wieder ertönt Beifall.
Ein Brasilianer geht ans Mikrofon und fordert eine Landreform, die ihren Namen verdient. Dann informiert Sofia Monsalve von der internationalen Nichtregierungsorganisation FIAN über die Auswirkungen der Weltbank-politik: die Privatisierung des Wassers, Biopiraterie, der Verkauf kollektiven Bodens. Nur in drei Ländern der Welt gebe es Bemühungen, eine Landreform im Interesse der Kleinbauern anzugehen: in Brasilien, auf den Philippinen und in – Venezuela. Auch Companero Felipe unterstützt die Regierung Chávez. Der Venezolaner habe völlig recht gehabt, als er jüngst seinen mexikanischen Kollegen Vicente Fox als »Schoßhund des Imperiums« bezeichnet habe.
Durchhalten
Im Sportstadion Poliedo steigt die Stimmung von Minute zu Minute. Aus dem Block Mitte-Rechts dröhnen Sprechchöre: »Uh-ah-Chávez no se va!« Mitte-Links legt nach. Ein Meer von Menschen mit roten Kappen auf dem Kopf springt auf, schwenkt kleine kubanische Fähnchen und reiht sich ein: »Uh-ah-Chávez no se va!« Dann legt wieder die andere Seite nach: »Viva Kuba, viva Venezuela!« Mitte-Links gibt nicht auf. Einige halten mehrere jener Plakate in die Höhe, die ständig und überall auf den Veranstaltungen des Forums auftauchen: Es zeigt ein mit Hitler-Bart verziertes Gesicht des US-Präsidenten George W. Bush. »Bush, fascista, terrorista«, brüllen die Rotkappen vom Block Mitte-Links ekstatisch, kurz darauf stimmt die ganze Halle ein: »Uh-ah-Chávez no se va!« Selbst die fünfköpfige marokkanische Delegation hüpft in ihren arabischen Gewändern von den Sitzen auf. Uh-ah-Chávez no se va – Chávez wird nicht gehen!
Genau genommen ist Chávez noch gar nicht gekommen, aber die Stimmung unter den gut 4000 Zuschauerinnen und Zuschauern ist bestens. Nach drei Stunden Parolen, Live-Bands und kleineren Tanzeinlagen zwischen den Stühlen tut sich dann etwas. Die revolutionären Gassenhauer werden angestimmt. »Comandante Ché Guevara, El Pueblo unido«, später auch die Internationale. Kubanische und venezolanische Fahnen, wohin man schaut. Zwei Indígenas tauchen auf der Bühne auf. Sie reden über Armut. Auf den Bildschirmen erscheinen Fotos von Bettlern, abgemagerten Menschen, Kindern. Dann eine Sirene, deren Signal langsam von Maschinengewehrknattern übertönt wird. Die Monitore zeigen Transparente gegen Bush und den Krieg. Wieder Musik. Entspannung.
Auf dem Podium sammeln sich indes einige Größen der globalisierungskritischen Bewegungen. Der Herausgeber von Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, die US-amerikanische Antikriegsaktivistin Cindy Sheehan und andere steigen auf die Bühne. Die Spannung steigt wieder, und dann endlich kommt er, er, auf den das ganze Stadion gewartet hat. Die Rotkappen kreischen, hüpfen auf den Bänken. »Das Volk liebt dich unendlich«, brüllen einige von ihnen. Im Scheinwerferlicht erscheint ein Mann mit knallig rotem Hemd, der mit einem bescheidenen Lächeln die Hand hebt und winkt. Die Bildschirme blenden Ché ein, dann Simón Bolívar, dann ihn: Hugo Chávez, den Popstar, den Helden.
Zunächst gibt ein Pfarrer der bolivarianischen Revolution und Chávez den Segen. Dann legt der Präsident los. Zwei Stunden lang erklärt er die Geschichte der Kolonialisierung, der Ausbeutung, des Imperialismus. Er spricht von seiner Freundschaft mit dem kurz zuvor gestorbenen salvadorianischen Guerillero und Politiker Shafik Handal, von der lateinamerikanischen Einheit, von Bush, dem »größten Terroristen auf dieser Welt«. Die Menge tobt, einige der eingeladenen Vertreter des globalisierungskritischen Establishments auf dem Podium klatschen begeistert, andere sind etwas zurückhaltender. Sie alle sagen an diesem Abend nichts. Sie wirken wie Dekoration, wie die zweite Garde des Zentralkomitees, während der große Vorsitzende über den »antiimperialistischen Kampf der Völker« referiert.
Zum Schluss seiner Rede geht Chávez auf die Diskussion um die Zukunft des Weltsozialforums ein. »Ein Forum, das diskutiert und diskutiert, ohne zu einer Konsequenz zu kommen, das erscheint mir seltsam.« Angesichts der zerstörerischen Kraft des Kapitalismus müsse das WSF dringend eine »alternative, antiimperialistische Bewegung für den Sozialismus« aufbauen. Dann hebt der Mann im roten Hemd wieder die Stimme und ruft: »Sozialismus oder Tod!« Und noch mal: »Sozialismus oder Tod!«, »Sozialismus oder Tod!« Etwa die Hälfte des Publikums hat die zwei Stunden nicht bis zum Ende durchgehalten. Alle gehen erschöpft nach Hause.
Am nächsten Tag titelte die forumseigene Zeitung Terraviva mit den Worten: »Sozialismus oder Tod«.
Hoffnung
Benjamin Nuven kommt aus der Sierra Norte von Ecuador, und wie für die meisten anderen Indígenas aus Peru, Bolivien, Kolumbien und Venezuela war für ihn die Anreise anstrengend und schwierig. »Wir wollen unsere Erfahrungen und den Prozess vermitteln, den wir in Ecuador durchgemacht haben«, sagt der Vertreter der Föderation der Indigenen und Bauern der Region Imbabura. Das WSF ist eine der wenigen Gelegenheiten, bei denen sich Menschen wie er aus verschiedenen Ländern treffen, um gemeinsam über ihre Situation als Indígenas in Lateinamerika zu sprechen.
Der Kampf für das Recht auf ein eigenes Stück Land führt auch Rosa Maria Ruiz nach Caracas. Die Bolivianerin setzt große Hoffnung auf den frisch gewählten indigenen Präsidenten Evo Morales. »Nun wird man die Rechte alle Bolivianer respektieren, unabhängig von Hautfarbe und Geschlecht, und nicht nur die Reichen«, hofft sie. »Ab jetzt wird der Reichtum des Landes für das Volk sein, und die Ausbeutung, die wir Jahrhunderte lang erlitten haben, wird ein Ende haben.«
Nachrichten
Fuerza Punto 4 berichtet aufgeregt: »Venezuela bereitet sich auf eine militärische Invasion vor«, meldet das der bolivarianischen Revolution nahe stehende Blatt zum Auftakt des WSF auf der Titelseite. Nach Angaben des Magazins »Im Vertrauen« des Fernsehsenders TeVe stehe ein Angriff der US-Militärs auf das Land bevor. Dies gehe aus geheimen Dokumenten der US-Armee hervor. Auch der befragte Militär (a.D.) Luis Cabrera Aguirre schließt den Angriff nicht aus. Doch dann beruhigt er die Leser: »Der venezolanische Staat mit Kommandant Chávez hat Maßnahmen ergriffen, die eine Invasion verzögern. Außerdem hat das heroische irakische Volk mit seinem Widerstand dafür gesorgt, dass sich die USA Aktionen dieser Art vorab genauer überlegen.« In den folgenden Tagen ist von der drohenden Invasion nicht mehr die Rede.
Perspektiven
Jahrmarkt der Zivilgesellschaft oder Ausgangspunkt weltweiter Kampagnen? Die Frage »wie weiter?« beschäftigt schon seit langem das höchste Gremium des WSF, den Internationalen Rat von rund 160 einflussreichen Organisationen. Das globalisierungskritische Großspektakel drohe in der Bedeutungslosigkeit zu versinken, so die Befürchtung, wenn man sich nicht auf gemeinsame Strategien oder Kampagnen einigen könne. Jacobo Torres de León verweist auf die erfolgreichen Mobilisierungen gegen die geplante gesamtamerikanische Freihandelszone. Andere fürchten, dass solche Versuche der Effektivierung und Vereinheitlichung das WSF unkritischer machen. »Wir suchen die Differenz, denn die ist ein wichtiger Wert unserer Bewegung«, erklärt der WSF-Mitgründer Cándido Grzybowski. Irene León vom Amerikanischen Sozialforum ergänzt, das WSF sei »pluralistisch und heterogen« gewachsen. Jetzt aber durchlebe das Forum »seine Krise des Erwachsenwerdens«.
Das Ende der Jugend wird offensichtlich eng mit der Integration in staatliche Institutionen in Verbindung gebracht. Jedenfalls wurde die Debatte um die Zukunft des WSF in Caracas häufig im Zusammenhang mit der Frage des Verhältnisses sozialer Bewegungen zum Staat geführt. Schließlich kann man in Lateinamerika in den letzten Jahren auf viele Wahlsiege linker oder gemäßigt linker Regierungen zurückblicken. Für Gonzaló Beron vom lateinamerikaweiten Bündnis sozialer Bewegungen Alianza Social Continental (ASC) ist diese Linkswende eine Herausforderung. »Nach den neunziger Jahren des Neoliberalismus müssen wir die Chance nutzen, mit Regierungen in den Dialog zu treten, die uns unterstützen können«, so der Sprecher der ASC. WSF-Koordinator Torres macht sich gleich ohne Umschweife dafür stark, künftig Politiker wie Boliviens Staatschef Evo Morales oder auch Brasiliens Präsident Inacio Lula da Silva bei den Wahlen zu unterstützen.
Eine gemeinsame Haltung in dieser Frage ist jedoch kaum zu erwarten. In den letzten Jahren konnten sich die Ausrichter des WSF nicht einmal darauf einigen, eine gemeinsame Abschlusserklärung zu verabschieden.
Alternativen
Die Alternative zur Alternative trifft sich in der Universität UCV oder im Zentrum der Organisation Nelson Garrido. Zur gleichen Zeit und in der gleichen Stadt, aber mit eigenem Konzept: antikapitalistisch, antimilitaristisch und antiautoritär. Auf dem Programm des Alternativen Sozialforums stehen Themen wie »Islamischer Fundamentalismus und Globalisierung«, »Anarchismus in Kuba« oder Guy Debords »Gesellschaft des Spektakels«.
Debatten über den »neuen Ausdruck von Militarismus und pseudosozialistischem Populismus« würden auf dem Weltsozialforum nicht akzeptiert, weil »Castro und Chávez zwei absolut militaristische und autoritäre Führer sind«, meint Humberto Decarli, ein Mitveranstalter und Rechtsanwalt. Das Weltsozialforum finde in einem Ambiente der sozialen Polarisierung in Venezuela statt, ergänzt Rafael Uzcátegul von der Zeitung El Libertario. Die sozialen Bewegungen seien in eine Falle geraten und hätten ihr eigenständiges Konzept aufgegeben, um sich nur noch an dem zu orientieren, was von oben komme. »Den kritischen Geist kann man aber nicht ausrotten, und in diesem Sinn klagen wir eine neue politische Agenda der Basisbewegungen ein.«