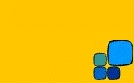Berichte
Steckt das Weltsozialforum in der Sinnkrise?
(von Philipp Kauppert, Friedrich Ebert Stiftung)
(Philipp Kauppert ist zur Zeit Praktikant im Büro der Friedrich Ebert Stiftung in Caracas)
Beim sechsten Weltsozialforum, das vom 24. bis zum 29. Januar in Caracas stattfand,
konnten auf die zentrale Frage, in welchem Verhältnis die sozialen Bewegungen und die
neuen linken Regierungen in Lateinamerika zueinander stehen sollten, keine klaren, vor
allem aber keine gemeinsamen Antworten gefunden werden. Nach dem Auftakt des in
diesem Jahr polyzentrisch angelegten Forums im malischen Bamako, das schließlich im
März im pakistanischen Karachi komplettiert werden soll, nahmen in Caracas rund
80.000 Menschen an knapp 2.000 verschiedenen Plena, Foren und Workshops teil. Der
zweimalige Auftritt des venezolanischen Präsidenten Hugo Chavez Frías stieß auf
verschiedenste Reaktionen: Auf der einen Seite erhoben sich immer wieder frenetische
Jubelchöre, auf der anderen Seite waren aber auch Kommentare der Ablehnung und der
Empörung über die populistischen Inszenierungen stark präsent. Vieles lag irgendwo
dazwischen.
Nach der Sperrung der Hauptverbindungsstrecke zwischen dem Flughafen und der
Stadt sowie der mangelnden Information über Schlafplätze, Orte und Inhalte der
Veranstaltungen bis kurz vor Beginn des Forums hatten viele der internationalen
Teilnehmer ein riesiges Organisationschaos vor Ort erwartet. Freilich dauerte der
Transport vom Flughafen in die Stadt teilweise bis zu sechs Stunden, zahlreiche kleine,
dezentral organisierte Aktivitäten wurden abgesagt, einige Konzerte fielen auf Grund
des unerwarteten Regens aus, das größte Camp lag zu weit außerhalb des Zentrums, und
die als große und öffentliche angekündigte Abschlussfeier wurde aufgeteilt in eine
folkloristische, inhaltsschwache Zeremonie einerseits und ein privates Treffen zwischen
Hugo Chavez und einigen wenigen Vertretern ausgewählter Organisationen
andererseits. Dennoch blieb ein größeres Chaos gerade durch den Einsatz der
zahlreichen venezolanischen und internationalen Freiwilligen aus: der Transport
zwischen den zehn verschiedenen Veranstaltungsorten innerhalb des Stadtgebiets war
weitgehend gut geregelt, die Camps auch aufgrund vieler Eigeninitiativen gut versorgt
und nach Auskunft vieler Aktivisten in bester Stimmung, und die meisten Konferenzen
wurden von mindestens einem (Englisch) bis zu vier Simultanübersetzern (außerdem
Französisch, Portugiesisch, Arabisch) begleitet. Der im Vergleich zu früheren Foren
noble Rahmen im Umfeld des Teatro Teresa Carreño und des Komplexes von Bellas
Artes war für viele ebenso neuartig wie die starke Präsenz des Militärs und der Vertreter
von Regierungsorganisationen, vor allem venezolanischer und kubanischer Herkunft.
Hugo Chavez: “Wer etwas verändern will, braucht Macht.”
So ließ sich Hugo Chavez als einzig präsenter Staatschef die Gelegenheit nicht
entgehen, vor gut 4.000 begeisterten Zuschauern im bewährt lockeren, volksnahen Stil
für eine “alternative, antiimperialistische Bewegung für den Sozialismus” zu werben.
Die von vielen Teilnehmern geforderte Unabhängigkeit des ursprünglich und prinzipiell
zivilgesellschaftlich orientierten Forums gegenüber den Regierungen war auch
gleichzeitig der Anstoßpunkt zur Kritik des venezolanischen Präsidenten. Vielmehr rief
er in steter Anlehnung an Fidel Castro dazu auf, die vielen gewonnenen Ideen jetzt in
die Tat umzusetzen: “Ein Forum, das nur debattiert, ohne zu Konsequenzen zu
kommen, bringt nichts.(…) Und wenn soziale Bewegungen wirklich etwas verändern
wollen, brauchen sie eben auch Macht.” Der diesjährige Organisator des Forums,
Jacobo Torres de León, hatte bereits auf der Auftaktkonferenz eingeräumt, dass er sich
der Gefahr einer politischen Instrumentalisierung des Forums durchaus bewusst sei. Er
glaube aber auch, dass gerade “die sozialen Bewegungen der letzten Jahre in
Lateinamerika die Basis für die neuen linken Regierungen geschaffen haben”, und man
deshalb mit fortschrittlichen staatlichen Kräften zusammenarbeiten müsse.
Folglich war es nicht sehr verwunderlich, dass das am meisten diskutierte Thema auf
allen Ebenen der “Sozialismus des 21. Jahrhunderts” war – ein Schlagwort, das vor
allem in der venezolanischen Öffentlichkeit auch abseits des Forums sehr vielseitig
benutzt wird. Auf den meisten Veranstaltungen zu diesem Thema war man sich
immerhin einig, dass ein solches Modell noch nicht existiere und erst noch konstruiert
werden müsse. Der kanadische Ökonom Michael Lebowitz erhielt starken Applaus des
Publikums, als er davon sprach, dass “die Grundsätze eines sozialistischen Modells in
der bolivarischen Verfassung Venezuelas verankert” seien, und man nun weitere
Schritte in diese Richtung machen müsse. Weniger Einigkeit herrschte dagegen bei der
Frage, in welche Richtung diese Schritte gehen sollten. Aleksandr Buzgalin, russischer
Ökonomieprofessor, appellierte, “aus den Fehlern Russlands zu lernen” und den
Sozialismus nicht als ein autoritäres Modell zu verstehen, das von einer staatlichen oder
intellektuellen Elite definiert würde, sondern vielmehr als “ein Modell der Kontrolle
und Teilhabe der Bevölkerung, von unten nach oben”. Ein konsumorientiertes
Rentenmodell seien ebenso Schritte zurück wie ein am industriellen Wachstum
orientiertes Wirtschaftsmodell. Michael Lebowitz beendete seinen Vortrag mit der
kritischen, vom Plenum jedoch unbeantworteten Frage, ob das Projekt Sozialismus in
Venezuela nur aufgrund des Ölreichtums möglich sei. Überhaupt hätte die
Diskussionsfreudigkeit der Referenten und der Teilnehmer, gerade bei den großen
Konferenzen, noch etwas ausgeprägter sein können.
Neben dem größtenteils aus venezolanischen Staatsgeldern finanzierten
Weltsozialforum organisierten einige radikalere Aktivisten ein kleines, alternatives
Sozialforum (“Foro Social Alternativo”), das betonte, “finanziell und inhaltlich
unabhängig von staatlichen Organisationen oder privaten Unternehmen” zu sein.
Basisaktivisten stellten im unsicheren und sehr politisierten Viertel des “23. Januar” (23
de Enero) ein “Campamento Internacional Bolivariano” auf die Beine, das als
Gegenentwurf zu den intellektualisierten Foren in zentralen Konferenzsälen bürgernahe
Diskussionsrunden mit kulturellen Events in die ärmere Stadtteile tragen sollte. Starke
Kritik der internationalen Teilnehmer, vor allem derjenigen nicht-lateinamerikanischer
Herkunft, erfuhr aber vor allem die Rolle des Militärs beim sechsten Weltsozialforum.
So konnten viele Aktivisten antimilitaristischer Bewegungen kaum ertragen, dass die
große antiimperialistische und pazifistische Auftaktdemonstration auf einem
Militärgelände stattfand, das von heroischer Kriegssymbolik in Form von
ausgemusterten Panzern und monumentalen Soldatenstatuen gesäumt war.
WSF-Gründer Grzybowski: “Das wertvollste an unserer Bewegung ist die Diversität.”
Die Frage nach der Sinnkrise der globalisierungskritischen Bewegung im Allgemeinen
und des Weltsozialforums im Speziellen war in Caracas sehr präsent. Man war sich
größtenteils einig, dass man aus der anfangs wichtigen Protesthaltung heraus, die sich
zunächst gegenüber dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos, aber auch immer wieder bei
WTO-Treffen oder bei G8-Gipfeln manifestierte, anfangen müsse, auch inhaltliche
Alternativen zu entwerfen. Cándido Grzybowski, brasilianischer Mitbegründer des
Weltsozialforums in Porto Alegre, zeigte sich dieser neuer Herausforderungen sehr
bewusst: “Wir sind an einem schwierigen Moment angelangt, wo wir nicht genau
weiterwissen. Das wichtigste ist aber, dass wir offen bleiben, unsere Diversität und
unsere Pluralität bewahren, das macht die kreative Spannung der Bewegung aus.” Auch
Samir Amin, ägyptischer Ökonom und Spezialist für Weltwirtschaftsfragen, kritisierte
die Simplifizierung der globalisierungskritischen Bewegung: “Wir müssen uns loslösen
von der Idee einer einzigen, klaren Alternative zum Kapitalismus, die es zu Zeiten des
kalten Krieges kursierte. Vielmehr müssen wir beitragen zur Konstruktion einer
multipolaren Welt, die auf einer Art Netzwerk des Internationalismus der Völker
basieren muss.”
Die nächsten großen Herausforderungen für das Weltsozialforum stehen bereits vor
der Tür: im März soll das letzte der drei polyzentrischen Foren 2006 in der
pakistanischen, erdbebengeplagten Stadt Karachi stattfinden, im kommenden Jahr soll
das kenianische Nairobi die Bewegung beherbergen, wo man in harten Verhandlungen
mit der dortigen Regierung stehe. Allein die gelungene Organisation eines großen,
internationalen zivilgesellschaftlichen Treffens in Asien oder in Afrika wäre schon ein
riesiger Erfolg, so die Organisatoren der zukünftigen Foren. Andere betonten, dass man
wieder verstärkt gemeinsame Kampagnen erarbeiten und diese in die einzelnen Länder
hinaustragen müsse. So wurde beispielsweise für den 18. März zu einem weltweiten
Aktionstag gegen Krieg und Militarisierung aufgerufen.
Nicht zuletzt ist auch noch die kulturelle Perspektive eines Forums zu erwähnen, das
sich das Motto “Otro mundo es posible” (“Eine andere Welt ist möglich”) auf die
Fahnen schreibt. Viele der Teilnehmer waren der Meinung, dass die Konstruktion einer
“anderen Welt” im Kleinen und gerade im Kulturellen bei jedem Einzelnen anfange.
“Wenn ich hier sehe, dass einige Teilnehmer Markenklamotten tragen und Produkte der
großen multinationalen Firmen konsumieren, verstehe ich nicht, was die hier wollen.
Wir müssen umdenken, wegkommen von der Konsumkultur, die uns eingetrichtert
wurde, kritischer werden auch mit uns selbst und unseren täglichen Gewohnheiten,
wenn wir etwas verändern wollen”, so Laurena Martín, eine spanische Aktivistin, in
einem der Camps. Kultur als Medium des politischen Wandels also. Nebenan singen
venezolanische Hip-Hopper von mehr Toleranz, US-Amerikaner tanzen zu kubanischer
Salsa, Palästinenser basteln an einer improvisierten Leinwand, um selbstgedrehte
Dokumentarfilme zu zeigen, und einige ecuadorianische Indígenas zeigen interessierten
Franzosen, wie man Armbänder flechtet.