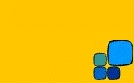Berichte
Manager des Weltgewissens
(von Ullrich Fichtner, Der Spiegel)
Filippo Addarii ist ein Italiener, der in London lebt. Er arbeitet mit Nigerianern, die in Stockholm wohnen, er kennt Holländer, die in Hongkong aktiv sind, er begegnet Deutschen, die es nach Jakarta verschlagen hat, und Bangladeschern, die in seiner Geburtsstadt Bologna leben, er trifft Dänen aus Kairo und telefoniert mit Brasilianern, die er aus Mumbai kennt. Tausende Adressen stecken in seinem Blackberry, er ist ein voll globalisierter Globalisierungsskeptiker, der gerade ein wenig den Überblick verliert.
Die Leute seines Workshops sind verschwunden. Er findet sie nicht am Tor 2 des kenianischen Nationalstadions, wo sich eben eine Demonstration für die Landrechte südasiatischer Flussvölker mit einer Kundgebung gegen die Misswirtschaft in Simbabwe vermischt. Ringsum kommen Menschen aus Zelten, oder sie federn die Treppen von den Stadiontribünen herab, es liegt ein großes Gemurmel in der Luft, gemischt aus den 300 Seminaren und Konferenzen des Tages, 1200 Veranstaltungen binnen sechs Tagen, beginnend am 20. Januar: Willkommen auf dem Weltsozialforum 2007 von Nairobi.
Filippo Addarii schwitzt, kleine Perlen, er findet keinen Schatten, obwohl er ihn dringend nötig hätte. Gleich am ersten Tag des Gipfeltreffens unterschätzte er die Kraft der Sonne und hat sich die Arme bis zu den Ellbogen verbrannt, Gesicht und Hals sind karmesinrot, die Haut schält sich, und der ganze Mann grinst schief, wenn ihm Kollegen im Vorübergehen freundschaftlich den Unterarm drücken.
Auf die Delegiertenkarte, die um seinen Hals baumelt, hat Addarii aus einer Laune heraus als Namen „Gott” geschrieben und als Adresse „Himmel”. Abgesehen von dieser Kinderei ist alles an ihm schneidend professionell, denn Professionalisierung, sagt Addarii, er ist erst 32 und schon ein Direktor des mächtigen britischen Netzwerks Acevo, ist für die Sozialbewegung die Forderung der Stunde.
Wenn der Italiener über die Kräfte der Zivilgesellschaft spricht, über den in England sogenannten dritten, also nichtstaatlichen und nichtkommerziellen Sektor, hört er sich an wie einer aus der Wirtschaft selbst, wie ein Consultant, wie ein McKinsey-Mann. Nichts haben seine Reden mit dem guten alten „Ehrenamt” zu tun oder mit Bürgerinitiativen, die hinter Tapeziertischen in Fußgängerzonen blasse Flugblätter gegen den Welthunger verteilen.
Die Initiativen müssten sich endlich selbst ernst nehmen, sagt Addarii. Sie müssten verstehen, wie wichtig ihre Rolle ist in einer Welt, in der sich die reichen Staaten immer weiter aus der Finanzierung öffentlicher Aufgaben zurückziehen, während in den armen Ländern der Staatssektor in aller Regel beharrlich versagt.
Die Zivilgesellschaft brauche Manager, die ihr Geschäft verstehen, ihre Unternehmungen brauchten eine Personalpolitik, die den Namen verdient, auch Menschenrechtler brauchten Businesspläne, auch Öko-Aktivisten müssten nachdenken über Fusionen, über Ökonomie, selbst wenn es bei all dem nicht um Profite in Euro und Dollar geht, sondern darum, das unbezahlbar Wertvolle, Richtige zu tun.
Eigentlich müsste einer wie Addarii lächeln über das Sozialforum und besonders über dieses in Nairobi. Von Anfang an ging hier fast alles schief, was schiefgehen konnte. Schon am Mittag des ersten Tages, als noch nicht einmal die Hälfte der Delegationen registriert war, gab es keine Programme mehr. Die engbedruckten Hefte, 176 Seiten stark, waren vergriffen, und bis zum Ende der Konferenz am Donnerstag wurden keine neuen nachgedruckt.
Ohne Ankündigung wurden reihenweise Seminare verlegt, Stromausfälle sorgten für stumme Lautsprecheranlagen, die Shuttle-Busse von und zur Innenstadt kamen im Wochenverlauf immer sporadischer. Im Medienzentrum blieben die Computersäle tagelang ohne Internet-Zugang, oder es fand sich für Stunden der Zuständige nicht, der die Schlüssel zu den verriegelten Schwingtüren gehabt hätte.
Ganz am Ende kreuzten am Tagungsort auch noch bewaffnete Diebe auf und nahmen Delegierte aus, mit vorgehaltenem Revolver, Straßenkinder fielen in Gruppen über die Zelte der Caterer her und stopften sich die Taschen mit Essen voll, das Organisationskomitee entzweite sich, weil die Kenianer keinerlei Rat annehmen wollten.
Sie hatten schon zuvor alle Angebote aus Porto Alegre ignoriert, bei der Organisation zu helfen, und das war ein Fehler. Dort, in Brasilien, fanden die Welttreffen mitten unter den Einheimischen statt, im Zentrum, unter den Leuten. Hier in Kenia befanden sich die Delegierten abgeschottet auf dem sterilen Sportcampus von Kasarani gut zehn Kilometer von Nairobis City entfernt. Die meisten Einheimischen wussten kaum, dass dieses Gipfeltreffen überhaupt stattfindet und erst Recht nicht, worum es sich eigentlich drehte.
Die Aktivisten drückten sich am Tagungsort unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegenseitig ihre Flugblätter in die Hand, und sie demonstrierten vor- und füreinander auf dem Betonring um das Stadion wie in einem satirischen Film. Filippo Addarii findet im Gewirr endlich ein gesuchtes Gesicht, es gehört Dele Ajayi-Smith, dem Chef einer nigerianischen Stiftung für die Entwicklung von Bürgersinn in Afrika. Ajayi-Smith ist ein lustiger, lauter Mann in traditionellem Gewand, der sich mit jedem fotografieren lässt. Sein Anliegen ist, mehr Demokratie zu wagen in Nigeria, er riskiert dafür seine eigene Haut, er glaubt daran, dass sich die Afrikaner selbst retten müssen, weil andere es nicht tun werden. Er zwickt Addarii jovial in den Arm und sagt: „Was ist das bloß für ein Tohuwabohu hier, Filippo?”
46.000 Delegierte sind registriert, 150.000 waren erwartet worden, vielleicht 25.000 irren wirklich Tag für Tag durch die Anlage: Inder, Chilenen und Franzosen, Tansanier, Kenianer und Kameruner, Spanier, Brasilianer und Kanadier. Sie suchen Räume und Seminare auf den Galerien des Nationalstadions, suchen den richtigen Tribünenabschnitt zwischen 24 Toren, die Wege sind lang, vom obersten Ring der Fußballarena kann man weit in die Landschaft hineinschauen, am Horizont beginnen die Slums von Nairobi, im Innern streckt sich sattgrün ein welliges Fußballfeld, gerahmt von einer Tartanbahn.
An Gate 11, oberer Ring, suchen Betschwestern eine Diskussion der Franziskaner-Mönche über den interkulturellen Dialog, aber im Tribünenblock sitzt ein Podium „Revolutionärer Proletarier”, die über die „Geschichte als Abfolge von Klassenkämpfen” reden, die Nonnen schrecken zurück und kichern wie junge Mädchen.
An Gate 7, unterer Ring, verlieren sich alte 68er aus Europa, selbst bald 68, auf den T-Shirts noch immer Hammer und Sichel und Che Guevara und den Stern von Vietnam. Sie wollen sich von der Rosa-Luxemburg-Stiftung informieren lassen über den „Kapitalismus in Afrika”, aber sie geraten, je nach Irrweg, in eine Konferenz der Anti-Schnittblumen-Kampagne oder in einen Vortrag finnischer Jungsozialisten über das „Nordische Modell” oder in die Präsentation eines Friedensplans für die Ituri-Region im Kongo, oder sie werden Zeugen eines Events gegen Walmart, Coca-Cola oder Shell, gegen die Nanooder die Gentechnologie, gegen George Bush, die G-8, die EU, die Weltbank.
Von Ferne betrachtet ist das Weltsozialforum nur ein Gewimmel ohne Gesicht, ein wilder Karneval der Kulturen. Aber wer sich die Mühe macht, genau hinzusehen, erkennt doch Struktur und entdeckt viele unterschiedliche Qualitäten. Die Weltbewegung von unten, die sich beim Start vor sechs Jahren als „Gegenkraft zu den Entwürfen und Diktaten des Imperialismus und Neoliberalismus” definierte, ist eine echte Regenbogenkoalition, aber nicht alle Farben strahlen gleich hell.
Es gibt die wirklich global agierenden, professionell aufgestellten Organisationen wie Amnesty International, die Anti-Landminen-Kampagne oder „Civicus”, reich an Mitgliedern, Ideen und Geld. Die Jahresberichte von Amnesty sind längst fester Bestandteil der öffentlichen Debatten geworden, die Landminengegner wurden ausgezeichnet mit dem Friedensnobelpreis, und auch sie sind zu zählen zur Bewegung, die den Slogan geprägt hat in allen Sprachen: Eine andere Welt ist möglich.
Civicus, mit Sitz in Johannesburg und Washington, mit Ablegern auf der ganzen Welt, brachte es fertig, in Russland etwa eine Diskussion von Bürgerrechtsgruppen mit Präsident Wladimir Putin zu organisieren, und der Staatschef kam wirklich und hörte zwei Stunden lang mürrisch zu.
Civicus-Chef Kumi Naidoo, ein Südafrikaner, der schon gegen die Apartheid kämpfte, geht in Nairobi herum und schüttelt Hände, er ist ein Star der Bewegung und hat es auch außerhalb ihrer Reihen zu Prominenz gebracht. Er wird von Nairobi direkt nach Davos fliegen, dorthin eingeladen zu einer Diskussion unter anderem mit dem britischen Premier Tony Blair.
Nicht jeder in Nairobi findet das selbstverständlich oder gar wünschenswert. „Es gibt Leute hier, die sind schockiert”, sagt Naidoo. „Die fragen, wie ich auf die Idee komme, so eine Einladung anzunehmen. Aber ich lasse mir das nicht nehmen. Ich meine, wenn wir nur 50 dieser mächtigen Männer in unsere Richtung ziehen, wenn wir sie dazu bringen, zuzuhören, zu lesen, dann ist das ein Erfolg."
Natürlich sieht Naidoo, er gehört zur indischen Minderheit in Südafrika, auch die Gefahren. Es dürfe nicht passieren, dass sich die Macht mit den Ohnmächtigen nur schmückt: „Wir müssen aufpassen, dass wir mit unseren Themen nicht kolonialisiert werden.” Aber es könnte ein Wechselspiel geben zwischen Davos und Nairobi: Die Weltführer in der Schweiz könnten sich die Inhalte der Weltverbesserer genauer anschauen. Und die Weltverbesserer könnten lernen, wie man Ideen in Form bringt und Wirklichkeit werden lässt.
Als großer Fisch im Schwarm der engagierten Retter und Helfer sieht Naidoo die Schwächen der eigenen Bewegung genau. Sechs Jahre nach dem Start lägen immer noch keine Pläne vor, nach denen die „andere Welt” gebaut werden könnte. Die Bewegung müsse aber den Weg finden „from Opposition to proposition”, sagt Naidoo, von der Kritik zur Konstruktivität. „Wir wiederholen uns ständig. Das ist nicht gut.”
Dieses Urteil betrifft besonders eine zweite große Gruppe, die sich in der Bewegung von jeher ausmachen lässt, man könnte sie die Meisterdenker nennen, Theoretiker aller politischen Schattierungen. Es gibt faszinierende darunter, große Gelehrte, Nobelpreisträger, die mit ihrem Leben einstehen für ihre Theorien. Es gibt aber auch abschreckende, und sie sind deutlich zahlreicher, gestrige Figuren und Vereine, die sich noch immer abmühen mit kommunistischen Weltformeln, wenn sie nicht gleich Plakate drucken lassen wie Pakistans Labour Party, auf denen Saddam unter dem Galgen zu sehen ist, und darunter steht die Parole: „Warum Saddam? Warum nicht Blair und Bush?”
Filippo Addarii sammelt am Tor 2 die Leute für seinen Workshop ein. Er hat schon eine Stunde Verspätung, aber das ist nicht viel bei diesem Kongress in Nairobi, es wird um „leadership” gehen, Führerschaft, um das Programm von Acevo. In Großbritannien hat die Organisation über 2000 Mitglieder, allesamt Chefs, Direktoren, Vorstandsvorsitzende großer Wohlfahrtsinstitutionen, alteingesessener Agenturen, Bürgervereinigungen, die in der angloamerikanischen Welt immer schon stärker waren als auf dem staatsgläubigen europäischen Kontinent.
Addarii steht in der prallen Sonne und hält ein Magazin seiner Organisation in die Luft wie ein Touristenführer. Es ist jetzt auch ein kenianischer Professor eingetroffen von irgendwoher, eine Feministin aus Kamerun, es fehlen noch Leute aus Nigeria, und die Abgeordnete aus Pakistan ist verschwunden, obwohl sie eben noch da war, Addarii raucht. Es zieht eine Truppe vorbei, die gegen die Ausgrenzung von Schwulen und Lesben demonstriert, dicht gefolgt von einer Demonstration johlender Kenianer, die für sich freies Essen und Gratis-Wasser auf dem Kongress fordern.
Auf den Tribünen des Stadions, deren Abschnitte man mit weißen Zeltbahnen und Styroporplatten zu beiden Seiten in kleine Säle verwandelt hat, geht es in endloser Variation um die Facetten der Globalisierungskritik. Die Kernpunkte sind einfach zu benennen: Das System globalen Wirtschaftens zeitigt ungerechte Effekte. Die armen Länder profitieren nicht oder viel zu wenig von der Globalisierung. Die großen Wirtschaftskonzerne sind so mächtig, dass sie den Staaten, und besonders den schwachen, ihre Bedingungen beliebig diktieren. Die internationalen Organisationen wie Weltbank, Währungsfonds und auch die EU dienen nicht den Entwicklungsländern, sondern den Interessen des Nordens, und ihre Politik zerstört, statt zu helfen, lokale Märkte und lokale Kulturen.
Man muss kein Radikaler sein, um an solchen Thesen Wahres zu entdecken. Nur scheint die Zeit gekommen, dass es das Weltsozialforum nicht mehr unbedingt braucht, um sie unter die Leute zu bringen. Noch vor wenigen Jahren war das anders.
Als in Porto Alegre schon über Klimawandel und Wasserknappheit, über die Gefahren der grünen Gentechnik und die Mängel internationaler Freihandelsabkommen diskutiert wurde, wollten die Regierungen und Wirtschaftsführer noch daran glauben, dass alles nicht so schlimm kommen und der freie Markt den Rest erledigen werde. Nun aber ist die Alarmstimmung zum Mainstream geworden, auch dank des Weltsozialforums, und es ist, als habe die Bewegung einen toten Punkt erreicht, als kranke sie.
Von diesem Befund sind die vielen kleinen lokalen Gruppen, die sich in ihren Ländern und Distrikten und Dörfern und Straßen beharrlich und unbeirrbar für eine humanere Welt einsetzen, am wenigsten betroffen. Sie bilden zusammen mit den Kirchen die dritte Gruppe innerhalb der Weltsozialbewegung, und es gibt Gründe, sie für die allerwichtigste zu halten.
In Nairobi sprachen Frauen aus Mali, die sich aufopfern im mühseligen praktischen Kampf gegen die Beschneidung der Mädchen. Aktivisten aus dem südindischen Bundesstaat Andhra Pradesh berichteten von ihren erfolgreichen Aktionen gegen die Kinderarbeit. Kenianer erzählten davon, wie sie in den Slums von Nairobi Kindergärten und Werkstätten aufbauen und erhalten. Jugendliche aus Malawi redeten über ihren Kampf gegen die dauernden Überschwemmungen entlang dem Thangadzi-Fluss, sie baggern dort teils mit bloßen Händen das Flussbett aus.
Bei vielen dieser Initiativen haben die Kirchen die Finger im Spiel. Sie sind vor allem in Afrika eine versichernde Macht, ein entscheidender Akteur der Zivilgesellschaft. Ihr Vorteil ist, dass sie nicht auf spektakuläre Kampagnen angewiesen sind, um irgendwoher Geld einzuwerben. Sie handeln aus sich selbst heraus, aus dem Glauben, das bringt Stabilität. Die Kirchen kümmern sich noch um Tschernobyl- und Tsunami-Opfer, wenn die Meute der privaten Helfer längst wieder abgereist ist.
Und es gibt Tausende Geschichten, in denen die Graswurzler und die Kirchenleute Hand in Hand gehen, fast jede ist ein Abenteuer der Menschlichkeit, und das Weltsozialforum ist die Bühne, sie alle zu erzählen. Es werden rund um den Globus pausenlos auch Menschen gerettet, einzelne, einige. Es kehrt Hoffnung zurück in Dörfer und Hütten, weil sich Menschen aufmachen, nicht die Welt zu retten, aber wenigstens, wie das Sprichwort sagt, ein kleines Licht anzuzünden, statt immer nur zu klagen über die große Dunkelheit.
Deshalb belächelt weder Filippo Addarii, der Italiener aus London, der Profi, noch Kumi Naidoo, der Südafrikaner aus Washington, das Getriebe des Forums. Sie wissen beide, dass die Graswurzelbewegungen und die Kirchen gebraucht werden, als Seele des Ganzen, auch wenn sie, im Licht der Öffentlichkeit, oft unbeholfen wirken. „Sie müssen bedenken”, sagt Naidoo, „dass diese Leute das ganze Jahr lang Berge besteigen. Hier können sie Dampf ablassen unter Gleichgesinnten.”
Auch Filippo Addarii würde gern Dampf ablassen, es fehlen noch immer Gäste seines Workshops, die Sonne steht nun so, dass am Tor 2 des Stadions nur noch ein schmaler Streifen Schatten übrig ist, auf dem Addarii keinen Platz mehr findet. Hinter Glasfenstern rumort das Pressezentrum, Agenturleute tippen mit der linken Hand Texte in Laptops, während sie an den Fingernägeln der Rechten kauen, eine dünne deutsche Korrespondentin stemmt die Arme in die Hüften und sagt: „Das ist vielleicht ein Scheiß hier.”
Er wird sich so schnell nicht wiederholen. Im kommenden Jahr wird es erstmals seit 2001 kein Weltsozialforum geben. Die Pause wird verkauft als Atemholen und Möglichkeit zur „Vertiefung der Ergebnisse”, aber wer die Cheforganisatoren bei den Pressekonferenzen sitzen sieht, spürt, dass das eine Notlüge ist.
Man hat sich müde gekämpft über die Jahre und vor allem im vergangenen. Der Weg nach Nairobi war steinig, und in manchen Sitzungen des Organisationskomitees ging es hässlich zu. Nur der Kontinent war immer klar, Afrika, aber über die Frage des Ortes wurde gestritten, als ginge es dabei um Krieg und Frieden. Die Frankophonen kämpften gegen die Anglophonen, die West- gegen die Ostafrikaner, die aus dem Süden waren gegen die Maghrebiner. Nigeria war im Rennen, Südafrika, Mali, Senegal, die Franzosen und Belgier wollten unbedingt Marokko, bis irgendwann irgendwie die Wahl auf Kenia fiel.
Dort steht im Gewühl vor dem Nationalstadion Filippo Addarii unter 20.000, 25.000 anderen, er plaudert auf Englisch mit Nigerianern, Kenianern. Er grüßt beim Herumgehen einen Schweizer, er tauscht Nettigkeiten aus mit einer alten Dänin, die er vom Weltforum in Indien kennt. „Wir haben uns in Mumbai gesehen”, sagt er, und sie antwortet: „O ja, Sie haben damals diese Rede gehalten.” Aber sie täuscht sich, sie drückt Addariis Arm, er lächelt.
Mit 20 Chefs von großen Agenturen, Clubs und Bürgerstiftungen aus Schwarzafrika wird er kurz später endlich aufbrechen zu seinem Workshop in einem Schulhaus in der Nähe. Dort wird ein langer Konferenztisch stehen, und Addarii wird für mehr Professionalität werben, für Vernetzung, für Fokussierung, für mehr Schlagkraft. Und er wird die Hilfe seiner Organisation anbieten, Acevo, das Know-how einer einflussreichen Truppe, ein frisches Stück Entwicklungshilfe, und die Afrikaner werden skeptisch, aber sehr interessiert sein.
Addariis Gruppe setzt sich jetzt in Bewegung am Stadiontor 2. Aus dem Zelt der Ökumene ein ganzes Stück weiter ist verwaschen Chorgesang zu hören, „Thank you, thank you, Jesus, merci, merci, Seigneur”, aber es kreuzt eine Trommlergruppe aus Uganda den Weg, und von den zwanziger Toren her nähert sich ein lärmender Zug von Feministinnen aus aller Welt. Für einen kurzen Moment sind alle Geräusche gleich laut, es ist nichts mehr zu verstehen.