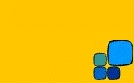Berichte
„Der Westen ist scheinheilig“
(von Christoph Kober, Die Zeit)
China und Indien engagieren sich in Afrika. Dies tun beide Länder aber nur, um dringend benötigte Rohstoffe auszubeuten, kritisieren europäische Entwicklungshelfer. Es gehe beiden Staaten gar nicht darum, die Lebensbedingungen der Menschen dort zu verbessern. Peter Niggli, Geschäftsleiter von Alliance Sud, der entwicklungspolitischen Arbeitsgemeinschaft der Schweizer Hilfswerke, findet das Vorgehen Chinas wie Indiens trotzdem richtig.
ZEIT online: Herr Niggli, der UN-Beauftragte zum Erreichen der Millenium-Ziele, Jeffrey Sachs, fährt durch Afrika und verteilt Moskito-Netze und Spezial-Dünger an arme Menschen. Ist in fünfzig Jahren Entwicklungshilfe so wenig passiert, dass Herr Sachs jetzt zeigen muss, wie es richtig geht?
Peter Niggli: Nein, das kann man so nicht sagen. Aber man muss klar festhalten, dass das, was lange Zeit Entwicklungshilfe genannt wurde, oft geopolitisch motiviertes Schmiergeld war. Bis zum Ende des Kalten Krieges war das die dominante Motivation für Entwicklungshilfe der großen Geberländer aus dem Westen. Viele dieser Gelder dienten der Finanzierung von Freunden und der eigenen Industrie. Nur ein geringer Teil ist tatsächlich in Gesundheitsprojekte, Bildung und soziale Entwicklung geflossen.
ZEIT online: Was halten sie von dem Modellprojekt, das Jeffrey Sachs in 79 afrikanischen Dörfern begonnen hat?
Niggli: Es kommt immer auf die Umsetzung an. Aber in konkrete Projekte zu investieren, scheint mir immer ein sinnvoller Ansatz zu sein.
ZEIT online: Sachs begrüßt auch das zunehmende entwicklungspolitische Engagement von Staaten wie China oder Indien. Sehen Sie das ähnlich?
Niggli: Ein Dialog mit diesen neuen Geberländern ist sicher richtig. Man sollte versuchen, Sie einzubinden, so gut es geht. Die große Nachfrage nach Rohstoffen, die von Asien ausgeht, ist zumindest kurzfristig ein Segen für Afrika. Der Kontinent hat wirtschaftliche Wachstumsraten, die man zuletzt in den sechziger und siebziger Jahren sehen konnte, als in Europa und den USA eine sehr starke Nachfrage nach diesen Rohstoffen herrschte. Das erleichtert es den Regierungen und der Wirtschaft in Afrika, einige Schritte vorwärts zu kommen.
ZEIT online: Inwieweit ist das aber Entwicklungshilfe?
Niggli: Das ist überhaupt keine Entwicklungshilfe. China und Indien brauchen einfach mehr Rohstoffe und fossile Energieträger. Sie treten als neue mächtige Nachfrager auf dem Weltmarkt auf, was in allen rohstoffreichen Ländern zu steigenden Verdiensten führt. Wir wissen, dass ein rohstoffreiches Land Gefahr läuft, keine diversifizierten wirtschaftlichen Entwicklungsziele mehr zu verfolgen, also eine Entwicklung außerhalb des Rohstoffsektors. Der Rohstoffreichtum kann auch dazu führen, dass die Eliten des Landes nur noch von der Rente leben, die die Ausbeutung dieser Ressourcen bietet, und sich gar nicht mehr um ihr Volk kümmern.
ZEIT online: Also sehen Sie das Engagement Chinas in Afrika doch kritisch?
Niggli: Mangelnde Diversifikation oder kleptokratisches Verhalten der Eliten sind typische Risiken rohstoffreicher Länder, unabhängig davon, wie gut die Geschäfte laufen. Wenn aber die Nachfrage zusammenbricht und die Erlöse absacken, wie das für Afrika in den achtziger und neunziger Jahren der Fall war, schwächt dies die Wirtschaft und verstärkt eher die Neigungen der Herrschenden, sich durch ihre Privilegien zu bereichern. Die heute blendende Konjunktur bietet deshalb bedeutend mehr Chancen für eine breitere wirtschaftliche Entwicklung. Und sie bietet auch mehr Anreize für die Regierungen, in diese Richtung etwas zu unternehmen.
ZEIT online: Die westlichen Geberländer kritisieren die Strategien der Chinesen als ausbeuterisch und gewissenlos.
Niggli: Zu kritisieren, dass jetzt die Chinesen ohne Rücksicht auf Menschenrechtsstandards operieren, ist etwas scheinheilig. China macht heute das, was die großen Geberländer früher praktiziert haben. Das Land engagiert sich dort, wo es sich Vorteile und Gewinne für seine eigene Wirtschaft verspricht. Dafür ist es bereit, Kredite zu vergeben und sich die Kooperation mit den entsprechenden Regierungen etwas kosten zu lassen. Außerdem haben die westlichen Geberländer selbst jahrelang Menschenrechtsstandards missachtet, wenn ihnen die betreffende Regierung ins geopolitische Kalkül passte. Solche Praktiken haben zudem im Gefolge des „Kriegs gegen den Terrorismus“ wieder zugenommen.
ZEIT online: Hat der moralische Ansatz die Entwicklungshilfe im Westen verändert?
Niggli: Anders als in China findet im Westen eine Diskussion über fragwürdige Praktiken in der Außenpolitik und der Entwicklungshilfe statt. So kritisieren zum Beispiel Hilfswerke in den USA sehr stark, dass dort die Entwicklungszusammenarbeit mehr als Begleitmaßnahme für militärische Intervention verstanden wird. Europäische Nichtregierungsorganisationen monieren seit langem, dass Entwicklungsländer Dienstleistungen und Warenbestandteile in den Geberländern kaufen müssen. Der große Unterschied zwischen den alten Geberländern und den neuen ist nicht, dass die einen die Standards immer beachten und die anderen nicht. Sondern, dass es im Westen einen Streit darüber gibt und somit die Möglichkeit einer Korrektur. Eine solche Debatte findet in China nicht statt.
ZEIT online: Trotzdem ist das chinesische Engagement in Afrika richtig?
Niggli: Ja, weil die erhöhte die Nachfrage aus Asien und die Möglichkeit, neue Kredite zu erhalten, den Spielraum für afrikanische Regierungen erhöht. Die wurden vorher wirtschaftspolitisch praktisch durch den Internationalen Währungsfonds und die Weltbank geführt. Diese extreme Abhängigkeit kann sich nun lockern.